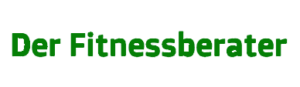Die Frage was besser ist zum Abnehmen (Cardio oder Krafttraining) ist schon so alt, weit ich im Fitnessbereich war und bin. Schauen wir uns diesbezüglich mal Untersuchungen zum viszeralen Fett an.
Bei einer Meta-Analyse von Khalafi et al. geht es thematisch um die Auswirkung von Krafttraining ohne und mit Kalorienbeschränkung auf das Viszeralfett. Letzteres wird auch als intraabdominales Fett bezeichnet. Wirbeltiere lagern es in der freien Bauchhöhle ein, um damit die inneren Organe, insbesondere jene des Verdauungssystems, zu umhüllen.
Allerdings gelten größere Mengen an viszeralem Fett als Hauptrisikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen sowie Typ 2 Diabetes und verschiedene Krebsarten. Damit wird Fettleibigkeit zu einer der häufigsten Todesursachen. Um Viszeralfett und Körpergewicht zu reduzieren, wurden immer wieder sportliche Aktivitäten wie Aerobic oder in letzter Zeit gerade hoch intensives Intervaltraining beschworen.
Allerdings blieben wissenschaftliche Nachweise dafür, gerade mit Blick auf das Krafttraining, bislang aus. Selbstverständlich sind viele gesundheitliche Vorteile mit Letzterem verbunden, aber eine viel beachtete Meta-Analyse des Forscherteams um Ismail aus dem Jahre 2012 gab den Hinweis, dass Krafttraining eben nicht zum Abbau von Viszeralfett taugt.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
Die besagte Meta-Analyse von Ismail weist allerdings größere Heterogenitäten auf, die möglicherweise daher rühren, dass ganz unterschiedliche Studien über Krafttraining sowohl mit als auch ohne Kalorienbeschränkungen einbezogen worden sind.
Es kann sehr gut sein, dass die Kalorienreduktion derart effizient das Viszeralfett vermindert, dass ein zusätzliches Krafttraining im wahrsten Sinne des Wortes kaum noch ins Gewicht fällt. Sehr wohl hat Krafttraining dann einen messbaren Effekt, wenn an der Ernährungsschraube nicht gedreht wird.
Vor diesem Hintergrund führten die Autoren der oben genannten Arbeit bewusst eine Neuauflage einer Meta-Analyse zur Wirkung von Krafttraining auf das Viszeralfett durch. Wie üblich begann auch diese wissenschaftliche Arbeit mit einer systematischen Durchforstung der schon vorhandenen Literatur zu diesem Thema.
Dabei ging es um alle Studien, die entweder das Krafttraining direkt mit einer Kontrollgruppe verglichen oder Krafttraining plus Kalorienbeschränkung mit einer entsprechenden Diät-Gruppe in Beziehung setzten.
Darüber hinaus sollten alle Studien peer-reviewed und in einem englischsprachigen Journal veröffentlicht worden sein, wobei die Teilnehmer einen gut messbaren Unterschied an Viszeralfett bezogen auf die Zeiten vor und nach den mindestens vierwöchigen Maßnahmen aufweisen sollten.
Die systematische Literaturstudie wies schließlich 34 Arbeiten aus, die all diese Kriterien erfüllten. In der Summe ergaben sich dabei 2.285 Probanden. Davon ging es in 13 Studien um den Vergleich zwischen Krafttraining plus Kalorienreduktion und einer entsprechenden Diät-Gruppe. In weiteren 22 Studien wurde das reine Krafttraining mit einer Kontrollgruppe verglichen, die keiner Einschränkung in der Ernährung ausgesetzt wurde.
Die Beteiligungen der Probanden dauerten in allen Fällen zwischen zwei Monaten und zwei Jahren. In einigen jener Studien, die Kalorienbeschränkungen einbezogen, wurde die Reduzierung der Nahrungsaufnahme relativ zum geschätzten Basis-Kalorienbedarf des jeweiligen Probanden individuell vollzogen.
So ergab sich eine Spannweite beim Zurückfahren des Nahrungsangebots von 250 bis zu 1.000 kcal pro Tag. In anderen Studien wurde dagegen die Kalorienzahl auf einen bestimmten Tagessatz (meistens um 800 kcal) festgelegt, und zwar gleichermaßen für alle Teilnehmer.
Die Häufigkeit des Krafttrainings rangierte zwischen zwei und sieben Tagen pro Woche. Bei 25 der 34 Studien waren es einheitlich drei Trainingseinheiten pro Woche. Die Meta-Analyse fand heraus, dass Krafttraining in Abwesenheit ambitionierter Kalorienreduktionen sehr wohl die Rückbildung viszeralen Fetts fördert.
Die Effizienz ist dabei aber mit d=0,24 nicht gerade umwerfend, dennoch waren die erreichten Unterschiede mit p < 0,001 sehr signifikant, wobei die Heterogenität in dieser Untersuchung mit I2 = 4.17 % und p = 0.4 ausgesprochen gering ist.
Untersuchungen an Untergruppen bestätigten die Robustheit der Ergebnisse. Das Krafttraining verminderte das Viszeralfett sowohl bei fettleibigen als auch bei normalgewichtigen Probenden deutlich. Auch ein höheres Alter der Teilnehmer schränkte den Erfolg in keiner Weise ein.
Der Vergleich der Gruppen „Krafttraining + Kalorienreduktion“ und „ausschließlich verminderter Kaloriensatz“ ergab mit p=0,09 keinen wirklich signifikanten Unterschied bei der Rückbildung des Viszeralfetts, wobei in der zweiten Gruppe sogar ein größerer Effekt (d=0,23) durchzuschimmern schien. Allerdings lag mit I2 = 58.76 und p = 0.003 eine hohe Heterogenität vor.
Betrachtet man die Waldgrafik beziehungsweise das Blobbogramm dieser beiden Gruppen etwas genauer, wird klar, dass es zwei Studien waren, die zu dem Schluss kamen, dass eine ausschließliche Kalorienreduktion zu bevorzugen ist, weil diese viel größere Werte auswiesen als die anderen Studien, die in der Meta-Analyse verwand wurden.
Daher macht es Sinn, diese beiden „Ausreißer-Studien“ nochmals einzeln durchzuschauen. Dabei fällt dann auf, dass die Teilnehmer der Gruppen „ausschließliche Kalorienreduktion“ mit circa 50 Prozent mehr viszeralem Fett in die Untersuchungen gingen als die Probanden der jeweiligen sportlichen Vergleichsgruppen.
Das erklärt, warum jeweils die zu vergleichenden Gruppen durchaus ähnliche relative Abnahmen des Viszeralfetts um ungefähr 30 Prozent aufwiesen, wobei aber der absolute mittlere Fettverlust in der Gruppe „ausschließliche Kalorienreduktion“ eindeutig größer war, was ja nur logisch ist, wenn das Experiment mit deutlich mehr Fettvorräten angetreten wird. Insofern führte die Einbeziehung dieser beiden Studien zu einem Effekt, als würden bestimmte Basiswerte doppelt gezählt werden.
Beide Studien wurden übrigens an derselben Institution durchgeführt, wobei die spätere Arbeit lediglich eine Fortführung der Ersteren mit ein paar zusätzlichen Probanden pro Gruppe darstellt. Insofern hätte man in die Meta-Analyse nur eine dieser Arbeiten einfließen lassen sollen. Nur so ist das Ergebnis zu erklären, dass der relative Verlust an Viszeralfett in den Vergleichsgruppen scheinbar identisch war.
Vor diesem Hintergrund kann man also den Schluss nicht gelten lassen, dass eine reine Kalorienreduktion hinsichtlich des Abbaus von viszeralem Fett fast noch effektiver ist als eine Kombination von Kraftsport und verminderter Nahrungsaufnahme.
Fazit
Aerobic mag noch ein bisschen effizienter funktionieren als Kraftsport bei dem Ziel, viszerales Fett abzubauen, so jedenfalls bescheinigt es die erwähnte Meta-Analyse von Ismail. Eine andere Meta-Analyse vom Team um Verheggen aus dem Jahre 2016 beschäftigte sich ebenfalls mit Studien zum Vergleich der Wirkungen von Kalorienreduktion und Aerobic-Übungen.
Letztere führten in der Tat zu einer geringeren (totalen) Gewichtsabnahme, aber dennoch zeigte sich durch Aerobic ein größerer Verlust speziell beim viszeralen Fett als bei den Teilnehmern, die sich ausschließlich beim Essen einschränkten.
Im Großen und Ganzen lässt sich also zusammenfassen, dass das Ziel, möglichst viel viszerales Fett zu verlieren, am besten mit einer Kombination aus Aerobic und Kalorienreduktion zu erreichen ist. Dabei wird sich ein Mix aus Aerobic und Krafttraining auf keinen Fall nachteilig auswirken.
Wer am Essen nicht so gern sparen möchte, erreicht möglicherweise mit Aerobic etwas mehr als mit Krafttraining. Wie anfangs eingeführt, ist viszerales Fett in der Tat eines der Hauptrisiken gleich für ein Bündel an Erkrankungen, die durch unseren modernen Lebensstil bedingt sind.
Ganz isoliert betrachtet mag Aerobic kombiniert mit einer Kalorienreduktion das Viszeralfett besser abbauen als Kraftsport-Übungen allein, doch das Geheimnis liegt am Ende immer in der Adhärenz, das heißt, in unserem Langzeitverhalten hinsichtlich einer gesunden Lebensweise, die neben einer reduzierten Kalorienaufnahme auch sportliche Aktivitäten jeglicher Art in den Tagesplan einbezieht.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Abnehm-Newsletter dazu an:
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2022 erstellt.