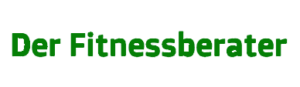Der PWC-Test (Physical Working Capacity) ist eine weit verbreitete Methode zur Messung der aeroben Fitness eines Menschen.
Er liefert wichtige Informationen über die körperliche Leistungsfähigkeit und kann sowohl im medizinischen als auch im sportlichen Kontext verwendet werden.
In diesem Beitrag werde ich mich mit den PWC-Tests 130, 150 und 170 befassen, ihre Auswertungsmethoden erklären und die Formel aufzeigen, mit der ihr eure eigenen PWC-Werte berechnen könnt.
Der PWC-Test
Für den Test braucht man einen Fahrradergometer. Das Gerät wird so eingestellt, dass die erbrachte Leistung zu Beginn 25 bis 50 Watt beträgt. Alle 2 oder 3 Minuten wird die Arbeitslast um 25 bis 50 Watt erhöht.
Die meisten Ergometer im Fitnessstudio kann man dazu getrost vergessen, da man an diesen Modellen keine Wattzahl mehr einstellen kann. Nur „Widerstände“, die aber drehzahlabhängig sind und keine konstante Wattzahl zulassen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Der Teilnehmer im PWC Test „arbeitet“ solange, bis er eine bestimmte Herzfrequenz (HFr) erreicht hat. Dieser angestrebte Pulswert richtet sich nach dem Alter und der eingeschätzten Leistungsfähigkeit.
Dabei wird oft die Grundregel „220 minus Alter“ angewendet, doch es gibt auch 3 Vorgehensweisen mit standardisierten Herzfrequenzen, die in der jeweiligen Belastungsstufe erreicht werden sollen: Puls 130, Puls 150 und Puls 170, entsprechend gibt es den PWC 130, den PWC 150 und den PWC 170.
Standardisierte Einstellungen erleichtern die Einschätzung und Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Daher gibt es solche Richtwerte auch für die zu steigernde Arbeitslast in jeder Leistungsstufe. Das WHO-Schema sieht eine Steigerung von 25 Watt alle 2 Minuten vor und das BAL-Schema eine Erhöhung von 50 Watt alle 2 Minuten vor.
Daneben wird auch das Hollmann-Venrath-Protokoll angewendet mit einer Leistungssteigerung von 40 Watt alle 3 Minuten mit einer Anfangslast von 50 Watt. Das gängigste Vorgehen besteht in einer Startbelastung von 50 Watt mit einer Steigerung von 25 Watt alle 3 Minuten.
Nachdem der Teilnehmer eine Leistungsstufe beendet hat, notiert der Therapeut / Trainer die Zeit, die gebraucht wurde, um den Zielpuls (130, 150, 170) zu erreichen beziehungsweise zu überschreiten. Der PWC-Wert ergibt sich dann aus der erzielten Leistung in der letzten und vorletzten Leistungsstufe (P1, P2) und der genauen Herzfrequenz nach deren Beendigung (HFr1, HFr2). Natürlich wird in die Berechnung auch das Körpergewicht mit einbezogen.
Auswertung
Die Formel zur Berechnung des PWC-Wertes lautet:
PWCX = [P1 + (P2 – P1) X (HFrX – HFr1) / HFr2 – HFr1)] / Kgw
Es bedeuten:
P1: Leistung der vorletzten Leistungsstufe
P2: Leistung der letzten Leistungsstufe
HFr1: Herzfrequenz nach der vorletzten Leistungsstufe
HFr2: Herzfrequenz nach der letzten Leistungsstufe
X: 130, 150, 170
Kgw: Körpergewicht
Beispielberechnung
Angenommen, eine Person hat im PWC 170 in der vorletzten Belastungsstufe (P1) einen Wert 250 Watt und in der letzten Belastungsstufe (P2) einen Wert von 300 Watt. Der „vorletzte“ Puls betrug 167, der „letzte“ 175. Der Teilnehmer wog 85 kg. In die Formel eingesetzt ergibt sich:
PWC170 = [250 + (300 – 250) X (170 – 167) / 175 – 167)] / Kgw
Weiter (Punktrechnung vor Strichrechnung, kennen wir!):
PWC170 = 250 + 50 X 3 / 8 = 250 + 18,75 = 268,75 und das ganze geteilt durchs Körpergewicht von 85 kg = 3,16
Dieser PWC 170 zeigt eine überragende Leistungsfähigkeit an. Bei einem Wert von knapp unter 3,0 wäre die Leistungs-Kapazität aber immerhin noch über dem Durchschnitt. Das ist beim PWC 130 schon bei einem Ergebnis von 2,0 der Fall.
Die geringste Leistungsfähigkeit besteht beim PWC 170 bei einem Wert von unter 1,5. Diese schwache Beurteilung folgt aus einem PWC 130 bei einem Wert von unter 0,5. Die durchschnittliche Leistungsfähigkeit, also beim PWC 150 beträgt rechnerisch zwischen 1,5 und 2,0.
Fazit
Der PWC-Test ist eine wertvolle Methode, um die aerobe Fitness eines Menschen zu bewerten. Durch die Durchführung eines PWC-Tests und die Berechnung des PWC-Werts erhalten Teilnehmer und Fachleute wichtige Informationen über die körperliche Leistungsfähigkeit. Die PWC-Tests 130, 150 und 170 bieten verschiedene Zielwerte, um individuelle Unterschiede in der Fitness besser erfassen zu können.
Die vorgestellte Formel ermöglicht es den Lesern, ihre eigenen PWC-Werte zu berechnen und ihre Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der PWC-Test nur eine von vielen Möglichkeiten ist, die kardiorespiratorische Fitness zu messen, und eine umfassende Beurteilung der Gesundheit und Fitness eines Individuums erfordert in der Regel weitere Untersuchungen.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
Dieser Beitrag wurde am 12.08.2023 erstellt.