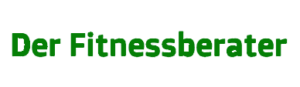Martin Halle ist Professor für „Präventive und Rehabilitative Sportmedizin“ an der TU München. Er bestätigt, dass das Sportlerherz im Ruhezustand relativ langsam schlägt. Aber warum ist das so und wo liegt hier die Grenze? Diese Fragen und was der Ruhepuls so alles über den Gesundheitszustand verrät, darüber gibt Professor Halle in diesem Beitrag Auskunft.
Das vegetative Nervensystem regelt nahezu alle Vorgänge im Körper. Es besteht aus dem parasympathischen und dem sympathischen Anteil. Ersterer regelt lebenswichtige Funktionen wie Herzschlag, Atmung oder Verdauung. Der Sympathikus ist immer dann gefordert, wenn wir schnell entscheiden und handeln müssen. Wer im Normalzustand einen ruhigen Puls hat, verfügt über mehr Dynamik nach oben, falls es mal ernst oder gefährlich wird. Wer dagegen schon auf der Couch einen rasenden Puls aufzeigt, kann bei Stress nichts mehr zusetzen.
Was ist ein niedriger Puls?
Der Ruhepuls eines Profisportlers kann bis auf 35 Schläge pro Minute heruntergehen. Sein Stoffwechsel verläuft in der Tat circa halb so schnell wie desjenigen, dessen Puls bei über 70 liegt. Man darf hier also von einer Art Energiesparmodus sprechen. Einschalten lässt sich dieser, indem der Sympathikus langsamer „feuert“ mit der Folge, dass der Sinusknoten im Herzen nicht so stark aktiviert wird.
Haupt-Taktgeber ist der Sinusknoten
In den Herzkammern gibt es zudem Zellen mit einer elektrischen Grundaktivität, die in etwa bei 35 Impulsen pro Minute liegt. Das bedeutet: Ohne Signale vom Sinusknoten wäre dies die Schlagfrequenz des Herzens. Es ist aber der Sinusknoten, der dafür sorgt, dass sich unser Ruhepuls eher bei 60 oder 70 Schlägen befindet.
Um den Sinusknoten etwas ruhiger takten zu lassen, braucht es über längere Zeit ein moderates, nicht zu intensives Ausdauertraining. Ob es sich dabei um Schwimmen, Laufen oder Radfahren handelt, ist relativ egal. Wer dabei zu forsch herangeht, bewirkt damit, dass der Körper Stresshormone produziert, was genau das Gegenteil von dem bedeutet, was man eigentlich erreichen möchte.
Durch ein langfristiges, moderates Training werden die Gefäße etwas geweitet und zugleich elastischer. Sogar der Herzmuskel wird etwas größer. Um die Körperfunktionen im Ruhezustand aufrecht zu erhalten, braucht das leistungsfähigere Organ nun nicht mehr viel tun.
Wann tritt eine solche wünschenswerte Anpassung in Kraft?
Bereits nach zwei Wochen regelmäßigen sportlichen Trainings kann sich die Pulsfrequenz um fünf Schläge erniedrigt haben. Im „Klinikum rechts der Isar“ der TU München läuft ein solches sportmedizinisches präventives Projekt in Kooperation mit dem Bayerischen Leichtathletik-Verband und dem Bayerischen Fernsehen (https://www.sport.mri.tum.de/de/projekte.html/). Dabei werden eher untrainierte Menschen innerhalb von zehn Wochen zu gesunder Bewegung erzogen. Danach ist deren Puls jeweils um circa 20 Schläge niedriger, sowohl in Ruhe als auch bei Belastung. Dies zeigt, dass man in recht kurzer Zeit eine Menge Herzleistung zulegen kann, wenn man nur will.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Abnehm-Newsletter dazu an:
Niedriger als 35 Schläge pro Minute wird der Puls dadurch aber nicht
So weit müssen wir es auch gar nicht kommen lassen beziehungsweise anstreben. Optimal pumpt das ruhige Herz mit 50 bis 60 Schlägen pro Minute. Gerade Patienten mit einer Herzmuskelschwäche sollten diese wohltuende Frequenz nicht signifikant unterschreiten, da sonst die Pumpleistung insgesamt zu gering werden könnte.
Bei Leistungssportlern ist das allerdings anders, weil deren Herz meistens so groß ist, dass es mit 35 Schlägen so viel Blutvolumen transportieren kann, wie es das Herz des Normalbürgers mit 60 Schlägen schafft. Überdies verfügen Sportler über eine verbesserte Sauerstoffverwertung, das heißt, sie brauchen etwas weniger Blut pro Einheit transportierten Sauerstoffs.
Die gute Nachricht ist, dass sich dies sogar die Patienten mit Herzinsuffizienz antrainieren können. Zwar können sie die Pumpleistung ihres Herzens kaum mehr verbessern, aber sie können zumindest ihre Muskeln in die Lage versetzen, den noch zur Verfügung stehenden Sauerstoff besser zu nutzen. Das macht sie nicht nur leistungsfähiger, sie fühlen sich auch viel besser.
Sport muss zur lebenslangen Angewohnheit werden
Was einmal antrainiert ist, ist nicht in Stein gemeißelt. Wer sich nach seiner sportlichen Phase entscheidet, wieder Couch-Potato zu sein, verliert jeglichen Gesundheitsbonus. So gut sich Leistungsfähigkeit und Gesundheit antrainieren lassen, so schlecht stellt sich auch der untrainierte Zustand wieder ein, wenn man alles schleifen und sich selbst gehen lässt. Wer beispielsweise aufgrund einer Verletzung drei Monate lang keinen Sport mehr treiben kann, muss mit einem Ruhepuls rechnen, der dem eines völlig untrainierten Menschen entspricht.
Übrigens: Dass Sport wie ein Medikament zu bewerten ist, sieht man auch daran, dass körperliche Bewegung sowohl überdosiert als auch unterdosiert werden kann.
Was alles sagt uns der Ruhepuls über unseren Gesundheitszustand?
Was wir so lapidar als Fitness bezeichnen, ist im Grunde genommen die aerobe Kapazität. Wenn diese hoch ist, besteht ein eher geringeres Risiko für Diabetes, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsformen.
Wenn wir sehr intensiv trainieren, schafft es der Durchfluss irgendwann nicht mehr, ausreichend Sauerstoff an die Muskeln zu bringen, und der Stoffwechsel wird anaerob. Wer aber gut trainiert ist, erzielt damit, dass sein Stoffwechsel deutlich länger im aeroben Bereich verharrt, das heißt, er kann zum Beispiel problemlos viel längere Strecken laufen. Das ist mit dem Begriff aerobe Kapazität gemeint.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Puls und der Herzfrequenz?
Mit jedem Herzschlag wird Blut gegen die Arterienwände gepresst und das spüren wir als Puls zum Beispiel an der Halsschlagader oder am Handgelenk. In der Regel sind Puls- und Herzschlag identisch. Dennoch gibt es sehr schwache Herztätigkeiten, die kaum eine spürbare Druckwelle in den Arterien verursachen. So kommt es immer wieder vor, dass Menschen bei Herzrhythmusstörungen einen vermeintlich niedrigeren Puls haben, als es ihrer Herzfrequenz entsprechen sollte. Mediziner bezeichnen dies als „Pulsdefizit“.
Gibt es auch Sportler mit einem relativ hohen Ruhepuls?
Das kommt schon mal vor, wenn sich ein gut trainierter Mensch eine Infektion eingefangen hat oder zum Beispiel im Verein mit Stress zu wenig schläft. Solche Situationen erhöhen den Ruhepuls um bis zu zehn Schläge pro Minute. Darüber hinaus ist die Überfunktion der Schilddrüse typisch für hohe Pulswerte, weil dadurch der Sympathikus das Herz schneller schlagen lässt. Falls der Ruhepuls gar nicht mehr auf sein normales Maß zurückgeht, könnte eine Insuffizienz vorliegen.
In einer noch recht aktuellen Studie wurde aufgezeigt, dass körperliches Training sogar für Menschen mit künstlichem Herzen zu empfehlen ist, weil dadurch ihre Belastbarkeit und damit ihre Lebensqualität gesteigert werden können. Gerade auf dem Feld der Kardiologie ist Sport unbedingt wie ein gesundes Medikament ohne Nebenwirkungen einzusetzen. Allein, eine „Überdosierung“ kann auch hierbei wie bei jeder Medizin gefährlich werden.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
Beitragsbild: stockxpert
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2021 erstellt.