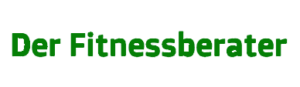Dieses Mal befassen wir uns mit einer noch relativ aktuellen Studie von Jayedi et al. (2021) unter dem Titel „Daily Step Count and All-Cause Mortality: A Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies“.
Im Rahmen dieser Metaanalyse geht es um den quantitativen Zusammenhang zwischen der täglichen Anzahl von Schritten und der Sterblichkeitsrate der Menschen. Zunächst mussten dazu mehrere Datenbanken nach möglichst allen prospektiven Kohortenstudien durchsucht werden. Auf der Grundlage der relevanten extrahierten Daten erfolgten eine Random-Effects-Metaanalyse und verschiedene Tests auf moderierende Variable. Anhand der GRADE-Kriterien wurden schließlich die Schlussfolgerungen evaluiert.
Eingeflossen in die Metaanalyse sind insgesamt sieben Studien mit mehr als 28.000 Teilnehmern. In Summe ergaben sich dabei 175.370 Personenjahre und 2.310 Todesfälle. Ein ganz wesentliches Ergebnis war hierbei, dass die Raten der Gesamtmortalität pro 1000 Schritte (täglich) um circa zwölf Prozent niedriger lagen (Hazard Ratio = 0,88; 95 % CI = 0,81 – 0,93).
Als potentielle Moderatoren wurden unter anderem folgende Verhältnisse angesehen:
- Studien mit längeren versus kürzeren Beobachtungszeiten
- Europäische Studien versus Studien aus den USA oder Asien
- Studien mit jüngeren versus älteren Teilnehmern
Da die Hazard Ratio für sämtliche Untergruppen der getesteten Studien zwischen 0,81 und 0,93 rangierte, ließ sich folgern, dass die Ergebnisse von diesen Moderatoren nicht sonderlich beeinflusst wurden. Gestützt auf die GRADE-Kriterien lässt sich ein hohes Maß an Sicherheit bezüglich einer Korrelation zwischen den Schrittzahlen und der Gesamtmortalität konstatieren.
Betrachten wir dazu kurz die Extremwerte: Das Ablaufen von 16.000 Schritten pro Tag war mit einer 66-prozentigen Verringerung der Sterblichkeit verbunden, im Vergleich dazu war das Gehen von nur 2.700 Schritten mit einem dreifach höheren Mortalitätsrisiko verknüpft.
Wissenschaftler sind sich darüber im Klaren, dass Korrelation nicht unbedingt Kausalität impliziert. Es kann ja sein, dass gesündere Menschen grundsätzlich eher dazu neigen, viel zu Fuß zu gehen. Damit wären hohe tägliche Schrittzahlen lediglich ein Indikator für einen guten allgemeinen Gesundheitszustand. Unter diesem Aspekt sind aber die Ergebnisse einer anderen Metaanalyse aus dem Jahr 2015 aufschlussreich.
Darin wurde aufgezeigt, dass gruppenbasierte Geh-Interventionen, die mehrere Monate andauerten, folgende Effekte nach sich zogen:
- Signifikante Abnahmen des systolischen Blutdrucks
- … des diastolischen Blutdrucks
- … der Ruheherzfrequenz
- … des Körperfettanteils
- … des Body-Mass-Index
- … des Gesamtcholesterins
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Bei den meisten Geh-Interventionsstudien sind die Anforderung an die Teilnehmer eher moderat. Dabei geht es zum Beispiel um 20 bis 30 Minuten Gehen pro Tag, dies entspricht Schrittzahlen zwischen 2400 und 3600.
Das bedeutet, dass bereits ein bisschen tägliches Gehen, das kaum ein Jahr lang durchgehalten wird, sogleich zehn verschiedene Risikofaktoren positiv verändert. Insofern ist also tatsächlich etwas dran an der negativen Korrelation zwischen Schritten und Mortalität.
Schaut man sich auch die Zahlen anderer Studien genauer an, kommt man sogar unweigerlich zu dem aufrüttelnden Schluss, dass eine stark sitzende Tätigkeit einen noch größeren unabhängigen Risikofaktor für die Gesamtmortalität darstellt als Rauchen oder Fettleibigkeit.
An all die engagierten Kraftsportler möchte ich daher diesen Appell richten: Euer Training ist wirklich eine wunderbare Sache für den Aufbau und Erhalt von Kraft und Muskelmasse. Es wird Euch gewiss helfen, länger unter lebenswerten Bedingungen fit zu bleiben. Aber es gibt in der Tat keinen Ersatz dafür, sich grundsätzlich über den ganzen Tag mehr zu bewegen.
Viele Untersuchungen haben uns gezeigt, dass Erwachsene in den USA durchschnittlich zwischen 5.100 und 6.500 Schritte pro Tag machen. Die vorliegende Metaanalyse weist nun nach, dass das Sterblichkeitsrisiko bei (nur) 6.000 Schritten pro Tag um circa 126 Prozent höher liegt als bei sehr aktiven Menschen, die jeden Tag 16.000 Schritte gehen.
Ich weiß sehr wohl, dass man sehr viel Zeit braucht, um so viele Schritte jeden Tag zu machen. Wer nun mal einem Bürojob nachgehen muss, in einer verkehrsreichen Stadt lebt, die nicht gerade zum Spazierengehen einlädt, und neben der Arbeit vielen Verpflichtungen nachkommen muss, dem ist diese Tür geradezu versperrt. Vielleicht leiden Sie auch unter einer Krankheit, die längeres Gehen verbietet. Trotzdem gilt immer der gute alte Spruch „Jeder Gang macht schlank“, den wir nun getrost erweitern können auf „Jeder zusätzliche Schritt macht uns ein bisschen gesünder“.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
Dieser Beitrag wurde am 8.7.2022 erstellt.