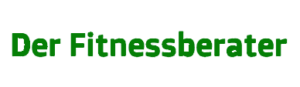Die Antwort lautet im Allgemeinen: Operation, denn der Glaube an die Chirurgie und deren Möglichkeiten ist nach wie vor ungebrochen. Dennoch: Wie es aussieht, trügt der medizinische Schein. Denn es hat sich herausgestellt, dass Bewegungsübungen genauso effektiv sind wie eine Operation für Leute mit chronischen Schmerzen im Vorderteil des Knies. Dieses Leiden ist bekannt unter dem Namen „patellofemorales Schmerz Syndrom“ oder PFPS.
PFPS wird zumeist mittels arthroskopischer Chirurgie behandelt. Dazu werden kleine Öffnungen ins Knie geschnitten, durch die ein Arthroskop, vergleichbar mit einem Endoskop, ins Knie geschoben wird. Mit Hilfe dieses Arthroskops ist der Chirurg in der Lage, das Knie von innen zu inspizieren, eine Diagnose zu stellen und vor Ort notwendige Eingriffe zu tätigen. Dies klingt gut, jedoch gibt es kaum stichhaltige Beweise, dass ein solcher Eingriff auch die beste Option ist.
Eine Studie aus dem Jahr 2007, durchgeführt von Wissenschaftlern des ORTON Research Instituts in Helsinki, Finnland, verglich den arthroskopischen Eingriff mit Bewegungsübungen bei 56 Patienten mit PFPS. Die finnischen Forscher initiierten diese Studie, da sie der Meinung waren, dass die Vorteile eines chirurgischen Eingriffs nicht belegt seien.
In der Studie wurden 56 Patienten mit PFPS zufallsmäßig in zwei Gruppen aufgeteilt: eine Gruppe mit Arthroskopie und einem 8-wöchigem Bewegungstraining zu Hause (28 Patienten) und eine Gruppe (28 Patienten) nur mit Bewegungsübungen. Als Resultat stellten die Forscher fest, dass in beiden Gruppen deutliche Verbesserungen eintraten. Allerdings waren die Verbesserungen in den beiden Gruppen nicht signifikant unterschiedlich.
Die einzige Signifikanz, die im Rahmen dieser Studie festgestellt werden konnte, waren Unterschiede in den Behandlungskosten. Die Behandlung der Arthroskopie-Gruppe war 901 Euro teurer als die der Referenz-Gruppe. Die Forscher kamen somit zu dem Schluss, dass ein chirurgischer Eingriff und Bewegungsübungen bei PFPS ähnlich wirksam ist wie Bewegungsübungen ohne Chirurgie (Link zur Studie).
Damit liegt auch der Schluss nahe, dass die positiven Effekte in der Arthroskopie-Gruppe möglicherweise nicht auf den chirurgischen Eingriff, sondern auf die sich anschließenden Bewegungsübungen zu Hause zurückzuführen sind. Wenn dem so wäre, dann wäre der chirurgische Eingriff nichts als ein superteures Plazebo.
Genau dieser Frage gingen Forscher des Baylor Colleges in Texas, USA, nach. Sie verglichen operative Eingriffe und Scheineingriffe bei 180 Patienten, die an Osteoarthritis des Knies litten (Link zur Studie). Der Beobachtungszeitraum erstreckte sich über 2 Jahre. Innerhalb dieser 2 Jahre gab es keine bemerkenswerten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen in der Bewertung von Schmerzen, Kniebeweglichkeit und –funktionalität. Die Forscher aus Texas schlossen aus ihren Beobachtungen, dass ein arthroskopischer Eingriff ins Knie keine besseren Resultate zeitigte als eine Scheinoperation.
Diese beiden Studien geben somit deutliche Hinweise, dass chirurgische Verfahren, auch wenn sie von der Schulmedizin als erprobt, sicher und effizient gelobt werden, nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein scheinen.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
Beitragsbild: fotolia.com – ThamKC