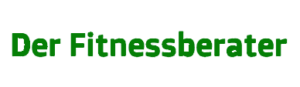Stickstoffmonoxid ist das neue Zaubermolekül, auf das sich das medizinische und pseudomedizinische Marketing seit geraumer Zeit gestürzt hat. Es soll angeblich wahre Wunder vollbringen, was Grund zu reichlich ausgeprägten Bemühungen gibt, jedem eine signifikante Erhöhung der körpereigenen NO-Konzentrationen zu empfehlen. Doch macht das überhaupt Sinn?
Als die ersten NO-Booster (und wie sie nicht alle heißen) auf den Markt kamen, wollte ich der Sache einmal nachgehen. Ist da etwas dran oder werden hier gewisse Fakten umgebogen, so dass sie unter dem Strich in erster Linie verkaufsfördernd sind? Denn: da werden Tests und alternative Präparate angeboten, die eigenartigerweise bei den naturwissenschaftlichen Arbeiten mit NO keine Rolle spielen…
Stickstoffmonoxid – ein fast ganz normales Molekül
Wer Stickstoffmonoxid liebt, der sollte sich immer vor Augen halten, dass die Substanz ein äußerst wirksames Gift ist, ein freies Radikal bzw. ein sehr potentes Oxidans. Normalerweise versuchen wir, Oxidantien zu eliminieren, indem wir verschiedene Arten von Antioxidantien zu uns nehmen. Stickstoffmonoxid ist extrem reaktiv, da es nur aus 2 Atomen besteht (Stickstoff und Sauerstoff), die eine „ungesättigte“ Verbindung eingehen. Wie bei allen freien Radikalen fehlt der Verbindung ein Elektron, das durch eine Reaktion mit Molekülen in der unmittelbaren Umgebung eingeholt wird.
Der „Drang“ nach einer „elektrischen Stabilisierung“ bzw. Reduktion des Moleküls ist so hoch, dass NO in Sekundenbruchteilen zu Stickstoffdioxid an der Luft umgewandelt wird. NO im Blut verbindet sich rasch mit dem Hämoglobin zu Methämoglobin, was die Transportkapazitäten des Hämoglobins für Sauerstoff herabsetzt. Unter physiologischen Bedingungen hat NO eine extrem geringe Halbwertszeit von nur 5 Sekunden, weshalb es permanent nachproduziert werden muss.
Es stellt sich jetzt die Frage, warum alle Welt so versessen ist auf so eine schreckliche Substanz?
Wissen die alle nicht, dass man sich hier mit einer „teuflischen“ Sache abgibt?
Glücklicherweise ist dem nicht so. Denn wie Paracelsus schon bemerkte, ist die Giftigkeit einer Substanz auch abhängig von seinen Konzentrationen. Zum einen trägt die extrem kurze Halbwertszeit von NO dazu bei, dass die Substanz rasch verschwindet. Aber dann ist der Schaden bereits eingetreten. Von daher wird unter physiologischen Bedingungen nur verschwindend wenig an Stickstoffmonoxid gebildet. Es wird gerade so viel synthetisiert, wie der Organismus für seine Funktion benötigt.
Spätestens hier wird die herausragende Rolle von Stickstoffmonoxid deutlich. Denn seine biologischen Funktionen scheinen „endlos“ zu sein. Es ist ein wichtiger Regulator und Vermittler von einer Reihe von Prozessen im Nerven-, Immun- und Herz-Kreislauf-System.
Die Erweiterung der Blutgefäße (Vasodilatation) ist ohne das Vorhandensein von NO nicht möglich. NO vermittelt hier die Phosphorylierung einer Reihe von Proteinen, was zu einer Erschlaffung der glatten Gefäßmuskulatur führt. Das Resultat ist ein verstärkter Blutfluss in dem betroffenen Gewebe.
Dieser gefäßdilatierende Effekt von NO spielt eine Schlüsselrolle bei der Kontrolle des Flüssigkeitsgleichgewichts bzw. -haushalts des Organismus durch die Nieren (extrazelluläre Flüssigkeitshomöostase). Weiter ist er wichtig bei der Regulation von Blutfluss (Rheologie) und Blutdruck. Und Sie haben es sicher schon geahnt: NO ist (fast) ein natürliches „Viagra“, da es bei der Erektion des Penis „auch ein Wörtchen mitzureden“ hat. Doch im Gegensatz zu Viagra induziert NO den Blutfluss in den Corpus cavernosum des Penis, indem es zyklisches GMP (Guanosin Monophosphat) aufbaut.
Von hier aus wird über einige Zwischenschritte die Erschlaffung der glatten Muskulatur erreicht, was den vermehrten Bluteinstrom erlaubt. Viagra dagegen hat an dieser Stelle keine Wirksamkeit. Die Substanz verhindert nur den vorzeitigen Abbau des zyklischen GMPs. Das heißt letztlich, dass ohne NO auch Viagra unwirksam ist.
Die Produktion von Stickstoffmonoxid ist bei Populationen, die in großen Höhen leben, signifikant erhöht. Dies wurde durch eine Arbeit aus dem Jahr 2007 belegt (Higher blood flow und circulating NO products offset high-altitude hypoxia among Tibetans: http://www.pnas.org/content/104/45/17593). Es zeigte sich, dass die Tibeter, die in einer Höhe von 4200 Meter und höher leben, eine 10-fach höhere NO-Konzentration aufwiesen als Amerikaner, die auf einer Höhe von 206 Meter leben. Diese Anpassung hilft diesen Leuten, Hypoxien zu vermeiden, indem die pulmonale Durchblutung heraufgesetzt wird.
Das Immunsystem dagegen nutzt die „teuflischen“ Qualitäten des Stickstoffmonoxids. Die Makrophagen sind in der Lage, unabhängig NO zu produzieren. Aber hier werden Mengen synthetisiert, die mehr als 1000 mal höher sind als sonst unter physiologischen Bedingungen.
Ziel dieses Unterfangens ist, die zytotoxischen (zellgiftigen) Eigenschaften des freien Radikals auszunutzen und gegen eingedrungene Keime einzusetzen. Dieses „Spiel mit dem Feuer“ kann aber auch ins Auge gehen. Bei einer fulminanten Infektion bzw. einer Sepsis kommt es zu einer ebenso fulminanten Produktion von NO seitens der Makrophagen. Dies führt zu einer so ausgeprägten Vasodilatation, dass eine lebensbedrohliche Hypotension (Blutunterdruck) droht.
Zudem sind ebenso Gewebeschäden aufgrund der hohen Konzentrationen an freien Radikalen zu erwarten.
NO dient darüber hinaus auch als Neurotransmitter zwischen Nervenzellen. Im Gegensatz zu den „normalen“ Neurotransmittern, die nur Informationen von einem präsynaptischen zum einem postsynaptischen Neuron transportieren, ist das Molekül so klein, lipophil, ohne Ladung und kann somit über weitere Strecken diffundieren und direkt in Zellen eindringen.
Dadurch ist es in der Lage, auch auf nahegelegene Neuronen einzuwirken, die nicht direkt über Synapsen miteinander verbunden sind. Die kurze Halbwertszeit garantiert hier, dass es nicht zu einem Chaos kommt. Denn die Transmittertätigkeit des Moleküls ist nur von kurzer Dauer und auf einen relativ engen Bereich konzentriert. Stickstoffmonoxide im Gehirn scheinen zudem an der Fähigkeit zum Lernen und dem Erinnerungsvermögen mit beteiligt zu sein.
Eine wichtige Quelle für NO ist die Nahrung. Grünes Blattgemüse und eine Reihe von Wurzelgemüsen, wie Rote Beete, beinhalten hohe Konzentrationen an Nitraten. Nach Verzehr und Resorption ins Blut konzentrieren sich die Nitrate im Speichel bis zu einer 10-fachen Konzentration.
Hier werden sie auf der Zungenoberfläche von „guten“ anaeroben Bakterien zu Nitrit reduziert. Dieses Nitrit wird wiederum geschluckt und reagiert im Magen mit dessen Säure und anderen reduzierenden Substanzen, wie Ascorbat. Dieser Vorgang synthetisiert signifikante Mengen an NO. Der biologische Sinn dieses Vorgangs liegt mit einiger Wahrscheinlichkeit in einer Schutzfunktion.
Über die NO-Produktion im Magen wird die Nahrung zusätzlich von schädlichen Keimen befreit. Zudem kann NO leicht durch die Magenwand diffundieren und den Blutfluss der Darmmukosa aufrecht erhalten. Einen ähnlichen Mechanismus scheint es auch auf der Haut zu geben. Hier werden Pilz- und Bakterieninfektionen verhindert, indem das Nitrat im Schweiß durch nützliche Bakterien zu Nitrit reduziert wird und dann durch die leicht saure Umgebung auf der Haut in NO.
NO ist ebenso im Herzmuskel wirksam, wo es die Kontraktilität und die Herzfrequenz senkt. Beides sind Parameter für den Sauerstoffbedarf des Herzmuskels. Von daher gibt es inzwischen immer mehr Hinweise, dass die Koronare Herzkrankheit auf einer gestörten NO-Produktion beruht oder zumindest durch diese begünstigt wird. Bei Diabetikern wurde festgestellt, dass diese fast durchgängig im Vergleich zu Nicht-Diabetikern unter einer eingeschränkten NO-Produktion litten.
Eine eingeschränkte Konzentration an NO kann zu Schäden im Gefäßsystem führen, wie z.B. zu einer Störung im Endothel der Gefäße und zu Entzündungen. Diese Schäden führen dann zu einer gestörten Blutversorgung der Extremitäten, was für den Diabetiker mit einem erhöhten Risiko für Neuropathien einhergeht. Aber auch die „typischen“ diabetischen Geschwüre, die schlecht oder gar nicht heilen, sind auf diesen Mechanismus zurückzuführen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Die Synthese von Stickstoffmonoxid
Stickstoffmonoxid kann auf chemischen und biologischem Weg synthetisiert werden. Weiter oben habe ich schon die chemische Variante beschrieben. Hier dient Nitrit als Ausgangsmaterial, das über einen Kontakt mit Säuren oder reduzierenden Agenzien zu NO umgewandelt wird. Die biologische Produktion dagegen greift auf spezifische Synthasen, NO-Synthasen zurück (NOS). Ausgangsprodukt ist hier ausschließlich die Aminosäure L-Arginin. Beim Menschen kommen 3 Isoformen vor, die von verschiedenen Genen gesteuert werden.
- eNOS – Dieses Enzym kommt hauptsächlich in den Endothelzellen der Blutgefäße vor und ist hier für die Produktion von NO zur Gefäßdilatation verantwortlich. Nitroglycerin und andere Nitro-Präparate aus der pharmazeutischen Industrie setzen ebenfalls NO frei. Im Gegensatz zum biologisch erzeugten NO, welches die Arterien beeinflusst und damit die Nachlast (Blutdruck) des Herzens herabsetzt, beeinflussen die Medikamente nur den venösen Bereich. Aber auch hier profitiert das Herz, da eine herabgesetzte Vorlast im venösen Bereich ebenfalls den Sauerstoffbedarf reduziert.
- iNOS – Dieses Enzym tragen die Makrophagen in sich, um eine vermehrte NO-Produktion zu ermöglichen.
- nNOS – Dieses Enzym ist in den Neuronen des ZNS zu finden. Hier übernimmt das Stickstoffmonoxid die Funktion eines Neurotransmitters.
eNOS und nNOS sind im menschlichen Organismus permanent vorhanden. Grund dafür ist die Notwendigkeit von NO und dessen sehr kurze Halbwertszeit. Von daher muss für einen dauerhaften Nachschub gesorgt werden. iNOS dagegen wird hauptsächlich durch Endotoxine und entzündungsfördernde Zytokine induziert.
In diesem Zusammenhang taucht natürlich die Frage auf, inwieweit man die Syntheserate erhöhen kann, um dadurch für z.B. sportliche Zwecke einen erhöhten Blutfluss zu erzeugen. Dies wäre theoretisch über die weiter oben erwähnten Medikamente möglich. Aber diese haben einen größeren Effekt auf den venösen Bereich des Gefäßsystems. Für höhere Leistungen im Sport sind jedoch verbesserte arterielle Bedingungen notwendig. Eine einfache Erhöhung der Arginin-Aufnahme böte sich da als nächstes an. Aber Arginin ist in so vielen Nahrungsmitteln enthalten, dass es schwer ist, Arginin zu vermeiden. Zudem ist der Organismus selbst in der Lage, Arginin zu synthetisieren. Eine vermehrte Aufnahme von Arginin über spezielle Nahrungsergänzungsmittel macht unter diesen Voraussetzungen keinen Sinn.
Da die Synthese von NO von den entsprechenden NO-Synthasen abhängig ist, gäbe es eine theoretische Möglichkeit, deren Aktivität zu erhöhen und auf diesem Umweg die Menge an NO zu steigern. Da diese aber genetisch kontrolliert werden, ist es so gut wie unmöglich, hier einen entscheidenden Einfluss zu nehmen, ohne hier ein mögliches Desaster auszulösen (genetisch modifizierte NO-Superproduktion – ein neuer Science-Fiction).
Da eine Infektion mit einer Induktion der iNOS einhergeht, die signifikant mehr NO produziert als eNOS und nNOS zusammen, wäre dies ein gangbarer und machbarer Weg. Allerdings haben Infektionen die üble Angewohnheit, die körperliche Leistungsfähigkeit herunterzusetzen, trotz massiver NO-Produktion. Also ist dies auch keine Lösung des Problems.
Auch ein Umschalten auf andere Ausgangsstoffe wird zeitweise angeboten. Unter https://www.advancedbionutritionals.com/Special-Offers/201207/CircO2–ABNFR472.htm z.B. wird Citrullin und nicht Arginin als NO-Lieferant angeboten und für „nur“ 60 Dollar die 30er-Packung Lutschbonbons als die überlegene Alternative ausgepriesen. Durch das Lutschen der Tabletten soll angeblich ein bakterieller NO-Produktionsprozess induziert werden, der sogar mit Teststreifen nachvollzogen werden kann.
Dazu lässt sich sagen, dass Arginin die einzige Ausgangssubstanz für eine biologische NO-Produktion ist. Citrullin ist neben NO ein begleitendes Endprodukt der Enzymkaskade. Oder mit anderen Worten: Arginin wird über 5 Zwischenschritte zu NO und Citrullin verstoffwechselt. Dass das Stoffwechselendprodukt Citrullin Ausgangsprodukt für ein weiteres Stoffwechselendprodukt, dem Stickstoffmonoxid, werden soll, klingt für mich eher nach einem biochemischen Legoland aus der Marketingabteilung.
Wie diese Reaktionsabläufe aus biochemischer Sicht aussehen, kann man unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:NOS_reaction.png&filetimestamp=20070529034027 einsehen.
Kann man NO messen?
Die Messung von NO ist nicht so einfach, alldieweil hier minimale Konzentrationen gemessen werden müssen. Eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 1993 (http://www.fasebj.org/content/7/2/349) zeigt die verschiedenen Möglichkeiten. Das ist lange her, aber es scheint sich bei der Messung von NO seit dem nicht besonders viel getan zu haben.
Die Ausnahme bilden die Messapparate, die inzwischen auf ein tragbares Format geschrumpft sind. Die wichtigste Messmethode, für die es ebenfalls tragbare Geräte gibt, ist die ozonbasierte Chemolumineszenz (https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19157006). Die Arbeit aus dem Jahr 2008 bezeichnet sie als die genaueste und am häufigsten eingesetzte Messmethode, und war auch schon in der eben erwähnten Arbeit aus dem Jahr 1993 Mittel der Wahl. Bei dieser Messung wird die Probe, die NO enthält, mit Ozon in Kontakt gebracht.
Da der Sauerstoff aus dem Ozon sofort und intensiv mit dem Stickstoffmonoxid reagiert, kommt es zu einer Emittierung von Lichtquanten seitens des sich bildenden Stickstoffdioxids. Diese Lichtquanten können dann mit Hilfe eines Photodetektors gemessen werden. Die Menge an Licht ist dabei direkt proportional zur Menge an NO in der Probe. Wichtig ist hier, dass die Messung in einem geschlossenen System durchgeführt wird. So wird bei der Messung von Atemluft von Patienten z.B. sichergestellt, dass keine Außenluft die Messergebnisse verfälscht. Dazu müssen die Patienten erst einmal NO-freie Luft einatmen, bevor die Messung der ausgeatmeten Luft erfolgt. Denn die „normale“ Luft/Atmosphäre enthält heute so viel NO, bedingt durch die Abgase von Industrie und Verkehr, dass hier ein empfindlicher Störfaktor für die Genauigkeit der Messungen zu erwarten ist.
Damit ist für mich die Idee, NO mit Hilfe von Teststreifen messen zu wollen, auch nichts anderes als marketingmäßiges Wunschdenken, dass neben falschen Alternativen in Sachen NO-Lieferant auch noch unnütze Tests versilbern will. Was da letztlich bei den Teststreifen getestet wird, ist für mich ein Rätsel. Selbst wenn hier NO aus dem Speichel getestet werden sollte, dann bliebe zu fragen, ob das wirklich NO aus dem Speichel ist oder nicht doch ein erheblicher Anteil aus der Luft. Da NO nur eine Halbwertszeit von 5 Sekunden hat, müsste der Test blitzschnell durchgeführt werden und unter Ausschluss der Luft, also alles Faktoren, die ein einfacher Streifentest nicht garantieren kann.
Fazit
Die Frage, ob man NO erhöhen kann, um die körperliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen, lässt sich leicht beantworten: Man kann. Man kann dies aber nicht durch fragwürdige Alternativen in Sachen Tabletten oder Nahrungsergänzungsmittel – nur ein etwas längerfristiger Aufenthalt in 4000 Meter Höhe würde zu diesem Resultat führen. Und wer gerne wissen möchte, wie viel NO er in seinem Organismus hat, der sollte sich an ein Labor seines Vertrauens wenden, die die geeigneten Testvorrichtungen vorzuweisen haben. Ansonsten schlage ich vor mehr Rote Beete zu essen oder Rote Beete Saft zu trinken – denn den finde ich nicht nur lecker, sondern der ist auch gesund.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an: