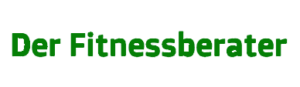Forscher der Kingston Universität in London fanden unlängst heraus, dass grüner und weißer Tee in der Lage sind, überhöhte Konzentrationen an Testosteron bei Athleten zu kaschieren.
Es hatte sich gezeigt, dass beide Teesorten in der Lage sind, ein illegales Doping mit hohen Dosen an Testosteron zu maskieren. Das Team um Prof. Declan Naughton von der „School of Life Science“ der Universität fand heraus, dass die Einnahme der Tees das Potential zeigte, die Menge an Testosteron im Urintest zu senken. Dies hätte natürlich signifikante Auswirkungen auf die großen Sportereignisse, wie die olympischen Spiele in diesem Jahr.
Das Forscherteam berichtet, dass sie sich die letzten vier Jahre mit diesem Phänomen beschäftigt hatten. Und wie es aussieht, sind ihre Beobachtungen die ersten bei denen Nahrungsmittel, Ernährung und Diät eine Veränderung des Metabolismus von Testosteron bewirken konnten. Sie untersuchten dabei eine Reihe von bestimmten Enzymen und deren Reaktion auf verschiedene Nahrungsmittel, um festzustellen, ob dies die Verweildauer von bestimmten Substanzen (wie zum Beispiel Krebsmedikamente) im Organismus verändert.
Eines der Enzyme ist für die Ausscheidung von Testosteron über den Urin verantwortlich. Catechine, die im weißen und grünen Tee, nicht aber im schwarzen Tee vorkommen, sind in der Lage, dieses Enzym zu blockieren, so dass es zu einer eingeschränkten Testosteronausscheidung durch den Urin kommt. Folglich bleiben die Dopingtests auf Testosteron negativ, obwohl sich hohe Konzentrationen an Testosteron im Organismus der Athleten befinden. Voraussetzung ist der Genuss von ausreichend hohen Mengen an Tee seitens der Athleten.
Die Catechine „überlisten“ die Nieren, indem sie die Enzyme davon abhalten, die für die Ausscheidung vorgesehenen Moleküle zu markieren, so dass die Nieren diese Moleküle nicht mehr erkennen und ausscheiden, sondern sie weiterhin im Organismus kreisen lassen. Die Forscher konnten in ihrer Arbeit zeigen, dass die Catechine der beiden Teesorten in der Lage waren, das Enzym bis zu 30 Prozent in seiner Aktivität zu hemmen. Die Menge an Catechinen in einer Tasse mit konzentriertem grünen Tee entspricht der Menge an Catechinen, die die Wissenschaftler für ihre Untersuchungen benutzten.
Aber noch kommen diese Ergebnisse vom Labortisch, nicht aus Studien mit menschlichen Probanden. Denn wenn dieser Effekt sich auch im menschlichen Körper reproduzieren lässt, dann wird eine vollkommen andere Vorgehensweise bei den Dopingtests notwendig werden. Ein einfacher Urintest wäre dann vollkommen sinnlos. Die World Anti-Doping Agency (WADA) fängt an, darüber nachzudenken, auch Blutuntersuchungen zur Regel werden zu lassen, um diese möglichen Schlupflöcher zu stopfen.
Prof. Naughton jedoch denkt, dass Blutuntersuchungen nicht ausreichend sind. Nach seiner Meinung haben seine Untersuchungen zeigen können, dass die Untersuchung von Haaren die einzig genaue Bestimmungsmethode ist. Denn die Substanzen bleiben in den Haaren deutlich länger als in anderem Gewebe, also auch im Blut. Und was noch wichtiger ist: Die Verweildauer hier ist vollkommen unabhängig von enzymatischen Prozessen, wie sie im Blut und Gewebe stattfinden. In diesem Bereich wären die Catechine der Tees ohne Bedeutung für die Interpretation der Befunde.
So wie es aussieht, ist für die Athleten, die sich nicht dopen, ein erhöhter Testosteronspiegel aufgrund des Genusses der Tees eine legale Form der Leistungsverstärkung. Der Athlet bekommt eine Prise extra Testosteron ohne selber welches aktiv einzunehmen. Somit käme es zu einem „Boosting“ nur aufgrund der eingeschränkten Ausscheidung von Testosteron. Aber, so gibt Prof. Naughton zu bedenken, ist auch denkbar, dass der Organismus Kompensationsmechanismen für bzw. gegen die eingeschränkte Testosteronausscheidung in Gang setzt, die diesen Effekt wieder zunichte macht. Bislang ist aber darüber noch nichts bekannt, da es noch nicht zu klinischen Studien gekommen ist. Das wäre der nächste notwendige Schritt in der Erforschung dieses Phänomens.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
Beitragsbild: fotolia.com – NataliTerr