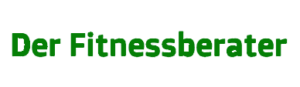Der globale Kampf gegen Bewegungsmangel ist aktueller denn je. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Bewegungsmangel als viertgrößten Risikofaktor für Todesfälle weltweit identifiziert. Allein in Amerika bewegen sich viele Menschen nicht genug, und selbst eine geringe Steigerung kann bereits tiefgreifende Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben. Laut einem Bericht des National Cancer Institute:
„Wenn Erwachsene in den USA im Alter von 40 bis 85+ ihre moderate bis intensive körperliche Aktivität um 10 Minuten pro Tag steigern würden, könnten etwa 6,9 % der jährlichen Todesfälle vermieden werden – 111.174 vermeidbare Todesfälle pro Jahr. Größere Vorteile waren mit einer größeren Steigerung der körperlichen Aktivität verbunden.“ [1]
- Deaths Prevented by Increasing Physical Activity – NCI
(https://dceg.cancer.gov/news-events/news/2022/deaths-prevented-exercise)
Um die mit einem sitzenden Lebensstil verbundenen Gesundheitsrisiken einzudämmen, ermutigen Gesundheitsexperten und staatliche Gesundheitsbehörden die Menschen jetzt, mehr Sport zu treiben. Und eine der effektivsten Lösungen, die jedem zur Verfügung steht, ist das Gehen. Es ist die einfachste und zugänglichste Form der Bewegung, und neue Forschungsergebnisse stellen es in den Mittelpunkt einer neuen Fitnessbewegung, die zu einer verbesserten allgemeinen Gesundheit führen wird.
Japanische Forscher haben zwei transformative Methoden entwickelt – Intervall-Walking-Training (IWT) und langsames Laufen. Diese Ansätze sind nicht nur effektiv, sondern auch an verschiedene Lebensstile und körperliche Bedingungen anpassbar.
Aber bevor ich auf diese interessante Methode eingehe, möchte ich noch ein paar „Warnschüsse“ vorab schicken, die sich auf Ansichten beziehen, die immer noch die Runde machen, aber dennoch immer noch falsch sind.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
Bewegung ist…
… kein Allheilmittel, um abzunehmen oder sich einzureden, die verhassten Extra-Pfunde auf den Rippen wären das Resultat von zu wenig Bewegung. Zu wenig Bewegung kann den Trend zu mehr Gewicht begünstigen, mehr als das aber nur in Ausnahmefällen. [2]
- Mythos: Übergewicht als Folge von mangelnder Bewegung?
(https://www.gesund-heilfasten.de/diaet/blog/uebergewicht-mangelnde-bewegung-mythos-2015/)
Man kann auch zu viel trainieren? Zu wenig ist klar…. Aber zu viel? [3]
- Wieviel Training ist zu viel? Und wieviel ist gut?
(https://www.der-fitnessberater.de/blog/wieviel-training-ist-zu-viel/)
Regelmäßige Bewegung verlängert das Leben und macht genau das, was man einem Apfel am Tag nachsagt: Es hält den Doktor aus dem Haus. [4]
- Regelmäßiger Sport schützt vor schwerem Krankheitsverlauf
(https://www.der-fitnessberater.de/blog/sport-schuetzt-vor-krankheit/)
Die meines Erachtens beste Kombi ist…. [5]
- Fastenwandern: Fasten und wandern sind eine beliebte Kombination
(https://www.gesund-heilfasten.de/fastenwandern/)
Wer etwas mehr für sich tun will, der sollte einmal einen Blick auf ein Ausdauertraining werfen. [6]
- Effektiveres Ausdauertraining
(https://www.der-fitnessberater.de/blog/effektiveres-ausdauertraining/)
Ein Überblick über das Intervall-Walking-Training
In einer Dokumentation mit dem Titel „Neue Erkenntnisse zum Gehen und Laufen“ untersucht Erica Angyal, Moderatorin bei „Medical Frontiers“, die steigende Popularität von IWT und langsamem Laufen in Japan als Lösung zur Eindämmung körperlicher Inaktivität, insbesondere bei Menschen mittleren und höheren Alters.
IWT stammt von der Shinshu University in Matsumoto, Japan und ist eine strukturierte Form des Gehens, bei der zwischen drei Minuten langsamem, entspanntem Gehen und drei Minuten zügigem Gehen gewechselt wird. Ursprünglich für Sportler entwickelt, wurde IWT inzwischen für alle Altersgruppen und Fitnessniveaus angepasst.
Um die Wirksamkeit von IWT zu quantifizieren, führte das Forschungsteam eine Studie mit drei Gruppen durch – eine, die nicht ging, eine, die täglich 10.000 Schritte ging, und eine, die 30 Minuten IWT machte. Die Studie ergab bemerkenswerte Ergebnisse: [7]
New Findings on Walking and Running – Medical Frontiers – YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=z71aHZ4scMs)
- Der systolische Blutdruck sank in der IWT-Gruppe viermal stärker als in der 10.000-Schritte-Gruppe. Der diastolische Blutdruck sank um das Zweieinhalbfache
- Forscher gehen davon aus, dass das Schlaganfallrisiko um bis zu 40 % sinkt, wenn die Teilnehmer diese Gewohnheit fünf Jahre lang beibehalten
- Depressionssymptome verringerten sich um 50 %
- Schlafeffizienz stieg um 12 %
Diese Ergebnisse unterstreichen die Fähigkeit von IWT, die kardiovaskuläre Gesundheit und das geistige Wohlbefinden deutlich zu verbessern. Darüber hinaus steigert IWT die Muskelkraft, insbesondere der Oberschenkelmuskulatur, und verbessert die aerobe Ausdauer. Insbesondere stellten die Forscher fest, dass Teilnehmer, die fünf Monate lang IWT machten, 12 % stärkere Oberschenkelmuskulatur hatten als die Gruppe, die nur 10.000 Schritte absolvierte.
Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil der erhöhten körperlichen Aktivität ist ein stärkeres Immunsystem. „Früher war ich oft krank, aber jetzt erkälte ich mich selten. Das ist eine große Veränderung“, sagt ein Teilnehmer. Und diese Aussage ist nicht nur anekdotisch – veröffentlichte Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Bewegung Ihr Immunsystem stärkt. Insbesondere produziert s [8]ie entzündungshemmende Zytokine, Neutrophile, Leukozyten, natürliche Killerzellen und Lymphozyten.
- Physical exercise as a tool to help the immune system against COVID-19: an integrative review of the current literature – PMC
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7387807/)
Erste Schritte mit IWT
Gehen ist eine der besten Möglichkeiten, Ihre Fitness und geistige Gesundheit zu verbessern. Davon abgesehen ist IWT eine ideale Wahl, da es leicht umzusetzen ist. Nose Hiroshi, der Erfinder von IWT, beschreibt im Folgenden, wie es geht (siehe Link #7 zum YouTube Video):
- Beginnen Sie damit, Ihre Muskeln richtig zu dehnen.
- Gehen Sie mit kleinen Schritten. Sie wissen, dass Sie die richtige Intensität erreicht haben, wenn Sie ein Gespräch mit einem Gehpartner genießen können.
- Erhöhen Sie die Intensität, indem Sie mit größeren Schritten gehen. Ihre Fersen sollten zuerst den Boden berühren, dann Ihre Zehen.
- Beugen Sie Ihre Arme im rechten Winkel und schwingen Sie sie weit hin und her, damit Sie auf natürliche Weise mit großen Schritten gehen können. Streben Sie eine Geschwindigkeit an, bei der Ihre Wadenmuskeln leicht angespannt sind.
- Wechseln Sie zwischen drei Minuten langsamem Gehen und drei Minuten schnellem Gehen.
- Streben Sie insgesamt 60 Minuten schnelles Gehen pro Woche an und verteilen Sie Ihre IWT-Sitzungen auf mehrere Tage.
Langsames Laufen – Steigerung der Intensität durch Gehen
Was ist, wenn Sie die Intensität steigern möchten, nachdem Sie sich an IWT gewöhnt haben? Hier kommt langsames Laufen ins Spiel. Laut „Medical Frontiers“ erfordert langsames Laufen mehr Anstrengung als IWT, aber nicht so viel wie Training mit höherer Intensität. Im Wesentlichen wird langsames Laufen als Training mit geringer Intensität angesehen, bietet aber ähnliche Vorteile wie Training mit mittlerer Intensität.
Das Tolle am langsamen Laufen ist, dass Sie die Vorteile nutzen können, ohne die hohe Disziplin aufbringen zu müssen, die ein Sportler braucht. Soya Hideaki, Ph.D., Fitnessforscher an der Universität Tsukuba, bemerkt: „Das Fortsetzen von Übungen mit mittlerer bis hoher Intensität erfordert hohe Motivation.“
Hideaki weist auch darauf hin, dass Ihre geistige Gesundheit trotz der geringeren Intensität davon profitiert. Seinen Untersuchungen zufolge aktiviert langsames Laufen Gene, die die Hippocampusfunktion ähnlich wie normales Laufen verbessern. Zum Kontext: Der Hippocampus ist an Lernen und Gedächtnis beteiligt, und frühere Forschungsarbeiten haben ergeben, dass Bewegung die Größe dieser Gehirnregion vergrößert. [9]
- Effects of Exercise on Brain and Cognition Across Age Groups and Health States – PMC
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9068803/)
Dazu gesellt sich noch die Tatsache, dass bei Morbus Alzheimer Neurone im Hippocampus absterben, was erklären würde, warum diese Form der körperlichen Bewegung das Risiko für Alzheimer vermindern kann. [10]
- Alzheimer: Ursachen, Verlauf, Diagnose und Therapie
(https://www.yamedo.de/alzheimer/)
Hideaki und sein Team führten in seinem Labor noch ein weiteres Experiment durch. Sie beobachteten sechs Wochen lang drei Mäusegruppen – die erste machte keine Übungen, die zweite lief mit geringer Intensität und die dritte lief mit hoher Intensität. Nach Durchführung der Tests hatte die Gruppe mit geringer Intensität ihre Hippocampusneuronen im Vergleich zur Gruppe ohne Übungen um das 1,7-fache erhöht. Die Gruppe mit hoher Intensität hatte ihre Hippocampusneuronen dagegen um das 1,3-fache erhöht.
Experimente mit Menschen haben diese Ergebnisse bestätigt. Mithilfe von MRT-Scans (Magnetresonanztomographie) stellte Hideaki fest, dass Teilnehmer, die leichtes Pedaltraining machten, eine erhöhte neuronale Aktivität im Hippocampus aufwiesen als Teilnehmer, die kein Training machten. Dies führte zu besseren Genauigkeitswerten bei einer Untersuchung nach dem Training.
Also, wie läuft man langsam? Laut der Dokumentation ist der Schlüssel, langsam genug zu laufen, damit Sie Ihr Lächeln behalten können. Achten Sie darauf, ein Tempo beizubehalten, das dem schnellen Gehen ähnelt, und halten Sie beim Laufen beide Füße vom Boden ab. Zum Vergleich: Beim Gehen ist immer ein Fuß auf dem Boden.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
Gehen ist eine Übung, die man nicht übertreiben kann
Der „moderne“ Mensch bewegt sich heutzutage nicht genug. Und obwohl die Rückkehr zur Bewegung Ihre Fitness und Ihren allgemeinen Gesundheitszustand verbessert, sollten Sie es nicht übertreiben – Studien zeigen, dass übermäßiges, intensives Training auch nachteilige Folgen haben kann. Diese Beobachtung wurde in einer Studie von Dr. James O’Keefe und Kollegen vom „Mid-America Heart Institute“ am St. Louis Hospital in Kansas City veröffentlicht. [11]
- Training Strategies to Optimize Cardiovascular Durability and Life Expectancy – PMC
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10121111/)
In der Studie stellten die Forscher fest, dass bei sitzenden Menschen, die mit dem Training beginnen, eine dosisabhängige Verbesserung verschiedener Gesundheitsmarker beobachtet wird. Dazu gehören eine geringere Sterblichkeit, Diabetes, Depression, Sarkopenie, Sturzrisiko und Osteoporose. Eine Steigerung der Intensität bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sich auch die Vorteile steigern. Kurz gesagt, es gibt eine Grenze, ab der man trainieren muss, um die Gesundheit zu verbessern, bevor sie sich verschlechtert.
Im Wesentlichen zeigt die Studie, dass Teilnehmer, die viel intensives Training absolvieren, beginnen, ihre Vorteile für die Langlebigkeit einzubüßen. Beispielsweise haben Personen in ihren 40ern und 50ern, die an Triathlons über die volle Distanz teilnehmen, ein bis zu 800 % erhöhtes Risiko für Vorhofflimmern.
Aus den Beobachtungen des Teams ging hervor, dass bei mäßig intensivem Training (definiert als Aktivität, bei der man leicht außer Atem kommt, sich aber noch unterhalten kann) ein klarer „Mehr ist besser“-Ansatz ohne erkennbare Obergrenzen besteht. Das bedeutet, dass man es nicht übertreiben kann, sodass man die körperlichen und geistigen Vorteile des Trainings immer wieder sicher nutzen kann.
Darüber hinaus verbessert moderate Bewegung, zu der Gehen (und damit auch IWT und langsames Laufen) gehört, die Überlebensrate insgesamt etwa doppelt so gut wie intensive Bewegung. Basierend auf diesen Informationen gibt es einen „Sweet Spot“, der durch regelmäßiges, moderates Training erreicht wird, anstatt durch intensives Training. Auf der Suche nach der „Goldenen-Zone“ fürs Gehen rät O’Keefe:
„Mehr ist eindeutig besser. Die größten Vorteile erzielt man, wenn man von einem sitzenden Lebensstil – 2.000 bis 3.000 Schritte pro Tag – auf 7.000 oder 8.000 Schritte pro Tag umsteigt. Hier haben Sie diese sehr starke Senkung der Sterblichkeit und eine Verbesserung der Überlebensrate. Das setzt sich bis etwa 12.000 Schritte pro Tag fort. Die meisten Studien zeigen, dass es bei 12.000 stagniert.“
Erweitern Sie Ihre Gehroutine
Die meisten Menschen profitieren vom Gehen. Sofern Sie keine ernsthaften Gesundheitsprobleme haben, empfehle ich Ihnen, es als Teil eines gesunden Lebensstils in Ihren Alltag zu integrieren. Das Tolle am Gehen oder an jeder anderen Übung mit mittlerer Intensität (IWT oder langsames Laufen) ist, dass es kostenlos ist und jederzeit und überall durchgeführt werden kann.
Wenn Sie lernen, wie man Gehen als Übung trainiert, schaffen Sie eine solide Grundlage, die es Ihnen ermöglicht, andere Trainingsformen hinzuzufügen. Tatsächlich gibt es bereits verschiedene Möglichkeiten, das Gehen zu genießen, wenn Sie Ihr Fitnessniveau gesteigert haben und nach größeren Herausforderungen suchen. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, Ihre Gehroutine aufzupeppen:
- Gehen mit einer Gewichtsweste – Das zusätzliche Gewicht beansprucht mehr Muskeln und hilft Ihnen, Kraft und Ausdauer aufzubauen. Beachten Sie, dass eine ungleichmäßige Gewichtsverteilung oder eine Kompensation durch eine Änderung Ihres Gangs zu Haltungsschäden und Muskel-Skelett-Problemen wie Rückenschmerzen oder Schulterzerrungen führen kann.
Um diese Risiken zu minimieren, ist es wichtig, mit einem leichten Gewicht zu beginnen und die Belastung schrittweise zu erhöhen, während sich Ihr Körper anpasst. Achten Sie dabei auf die richtige Passform und Gewichtsverteilung Ihrer Weste. [12]
Low Volume, Home-Based Weighted Step Exercise Training Can Improve Lower Limb Muscle Power and Functional Ability in Community-Dwelling Older Women – PMC
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6352105/#abstract1) - Nordic Walking – Dabei wird mit Skistöcken fester Länge gelaufen. Dabei werden 90 % der Muskeln beansprucht, was ein Training für den Unter- und Oberkörper in einem darstellt. Außerdem wird bei gleicher Geschwindigkeit etwa 18 % bis 25 % mehr Sauerstoff verbraucht als beim Laufen ohne Stöcke. [13]
Nordic Walking at Maximal Fat Oxidation Intensity Decreases Circulating Asprosin and Visceral Obesity in Women With Metabolic Disorders – PMC
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8446531/) - Spaziergänge im Freien – Spaziergänge im Freien, insbesondere in Waldgebieten, bieten erhebliche psychologische Vorteile, die über die eines normalen Spaziergangs hinausgehen. Es hat sich gezeigt, dass diese Spaziergänge in der Natur die geistige Gesundheit erheblich verbessern, indem sie eine Reihe negativer Gefühlszustände verringern.
Die Teilnehmer berichten häufig von weniger Depressionen, weniger Anspannung und Angst, weniger Wut und weniger Müdigkeit und Verwirrung. Spaziergänge im Freien zur Mittagszeit – mit minimaler Kleidung – maximieren auch die Vorteile der Sonneneinstrahlung.
Wenn Sie jedoch Pflanzenöle nicht aus Ihrer Ernährung gestrichen haben, empfehle ich Ihnen, intensive Sonneneinstrahlung zu vermeiden, da dies dazu führen kann, dass die Omega-6-Linolsäure in Ihrer Haut oxidiert und Sonnenbrand verursacht. Gehen Sie stattdessen am frühen Morgen oder am späten Nachmittag nach draußen. Wenn Sie mindestens vier bis sechs Monate lang auf Pflanzenöle verzichtet haben, können Sie zur Mittagszeit nach draußen gehen. [14]
Psychological Benefits of Walking through Forest Areas – PMC
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6313311/) - Eine hervorragende Form, Sonnenbrand natürlich zu vermeiden, ist der Einsatz von Astaxanthin. [15] [16] [17]
Astaxanthin: Nutzen, Studien und Anwendung
(https://www.vitalstoffmedizin.com/vitaminoide-astaxanthin/)
Wundermittel Astaxanthin?
(https://www.vitalstoffmedizin.com/astaxanthin/)
Krill Öl – oder wie Astaxanthin wirkt
(https://vitalstoffmedizin.com/blog/krill-oel-wie-wirkt-astaxanthin/) - Spazierengehen mit einem Freund – Wenn Sie Ihren Spaziergängen ein soziales Element hinzufügen, sind sie noch nützlicher. Laut Dr. O’Keefe heißt es:
„Zur gleichen Zeit Sport zu treiben und soziale Kontakte zu knüpfen, ist eine wahre Goldgrube für ein langes Leben. Das bedeutet, dass sogar das Spazierengehen mit Ihrem Hund oder Ihrem Freund … großartig ist … Es geht darum, Ihren Körper auf eine lustige, spielerische Weise zu bewegen und sozial zu sein.“ - Gehen mit einem Ziel – Nutzen Sie die Zeit, die Sie mit Gehen verbringen, für kreative Zwecke, zum Lernen oder für Produktivität. Nutzen Sie die Zeit nicht nur zum Hören von Hörbüchern oder Podcasts, sondern auch zur Selbstreflexion oder zum Brainstorming.
Deborah Grayson Riegel, die an der „Fuqua School of Business“ der Duke University Führungskommunikation lehrt, schrieb in der Harvard Business Review:
„Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, William Wordsworth und Aristoteles waren allesamt zwanghafte Spaziergänger, die den Rhythmus des Gehens nutzten, um Ideen zu entwickeln. Und während jede Form von Bewegung nachweislich das Gehirn aktiviert, ist Gehen auch ein nachgewiesener Kreativitätsförderer.“ [18]
Don’t Underestimate the Power of a Walk
(https://hbr.org/2021/02/dont-underestimate-the-power-of-a-walk)
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
[1] Deaths Prevented by Increasing Physical Activity – NCI
(https://dceg.cancer.gov/news-events/news/2022/deaths-prevented-exercise)
[2] Mythos: Übergewicht als Folge von mangelnder Bewegung?
(https://www.gesund-heilfasten.de/diaet/blog/uebergewicht-mangelnde-bewegung-mythos-2015/)
[3] Wieviel Training ist zu viel? Und wieviel ist gut?
(https://www.der-fitnessberater.de/blog/wieviel-training-ist-zu-viel/)
[4] Regelmäßiger Sport schützt vor schwerem Krankheitsverlauf
(https://www.der-fitnessberater.de/blog/sport-schuetzt-vor-krankheit/)
[5] Fastenwandern: Fasten und wandern sind eine beliebte Kombination
(https://www.gesund-heilfasten.de/fastenwandern/)
[6] Effektiveres Ausdauertraining
(https://www.der-fitnessberater.de/blog/effektiveres-ausdauertraining/)
[7] New Findings on Walking and Running – Medical Frontiers – YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=z71aHZ4scMs)
[8] Physical exercise as a tool to help the immune system against COVID-19: an integrative review of the current literature – PMC
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7387807/)
[9] Effects of Exercise on Brain and Cognition Across Age Groups and Health States – PMC
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9068803/)
[10] Alzheimer: Ursachen, Verlauf, Diagnose und Therapie
(https://www.yamedo.de/alzheimer/)
[11] Training Strategies to Optimize Cardiovascular Durability and Life Expectancy – PMC
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10121111/)
[12] Low Volume, Home-Based Weighted Step Exercise Training Can Improve Lower Limb Muscle Power and Functional Ability in Community-Dwelling Older Women – PMC
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6352105/#abstract1)
[13] Nordic Walking at Maximal Fat Oxidation Intensity Decreases Circulating Asprosin and Visceral Obesity in Women With Metabolic Disorders – PMC
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8446531/)
[14] Psychological Benefits of Walking through Forest Areas – PMC
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6313311/)
[15] Astaxanthin: Nutzen, Studien und Anwendung
(https://www.vitalstoffmedizin.com/vitaminoide-astaxanthin/)
[16] Wundermittel Astaxanthin?
(https://www.vitalstoffmedizin.com/astaxanthin/)
[17] Krill Öl – oder wie Astaxanthin wirkt
(https://vitalstoffmedizin.com/blog/krill-oel-wie-wirkt-astaxanthin/)
[18] Don’t Underestimate the Power of a Walk
(https://hbr.org/2021/02/dont-underestimate-the-power-of-a-walk)