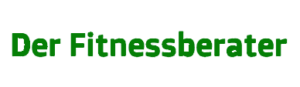Was stimmt denn nun? Die Forschung zu den besten Dehnübungen vor dem Training bleibt, das muss man ehrlich zugeben, uneinheitlich. Einst wurde uns beigebracht, dass dynamisches Dehnen (also Federn und Wippen) angeblich schädlich sein und man nur noch statisch Dehnen sollte (das Halten einer Dehnposition über längere Zeit). Dann war statitisches Dehnen auf einmal Unsinn oder gar „gefährlich“, vor sportlicher Belastung sollte man das nicht durchführen, usw. In meinem Grundsatzbeitrag zum Stretching, hatte ich dieses Hin und Her schon mal „zerlegt“: Stretching: Fang endlich an „richtig“ zu trainieren!
Genau so, erlebe ich die Sportwissenschaft seit über 40 Jahren. Und ich habe das ja auch noch studiert…
Da darf ich aus heutiger Sicht sagen: Gut, dass wir seinerzeit nicht auf die „Wissenschaftler“ gehört haben, sondern auf die Trainer, die wussten wovon sie reden – und auch entsprechende Erfolge vorzuweisen hatten.
Ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass die Theoriemodelle welches Dehnen, wann und warum am besten wirkt heute alle da sind. Die Anatomie um die Bedeutung der Faszien und die Forschungen dazu (seit wir das mit den Faszien wissen), ist ziemlich klar.
Und heute sind wir wieder beim dynamischen Dehnen, mit dem ich in der Jugend angefangen hatte. Es lebe Turnvater Jahn, bei dem das immer praktiziert wurde. Naja… Turnvater Jahn kennen auch nur noch die Wenigsten.
Also: heute im Jahr 2025, nach zahlreichen wissenschaftlichen Studien und praktischen Erfahrungen, neigen immer mehr Experten dazu, sich für dynamisches Dehnen zu entscheiden, das die Muskulatur nicht nur mobilisiert, sondern die Blutzirkulation fördert und das Verletzungsrisiko minimiert.
Dynamische Dehnübungen sind ein bewegter Tanz zwischen Flexibilität und Kraft, sie integrieren gezielte, kontinuierliche Bewegungen, die den Körper auf Betriebstemperatur bringen, bevor er in die eigentliche Belastung geht. Die „weltbeste Dehnübung“, die sich mittlerweile vieler Anhänger erfreut, ist nicht mehr ein passives Halten, sondern ein fließender, dynamischer Prozess. Ein Ausfallschritt nach vorne, dann zurück, eine halb-kniende Windmühle – alles Bewegungen, die den Kreislauf aktivieren, die Gelenke in Schwung bringen und die Muskeln (und vor allem die faszialen Strukturen) auf die anstehende Herausforderung vorbereiten. Die Wirkung ist spürbar und sofort: Mehr Mobilität, weniger Steifheit, und das Verletzungsrisiko sinkt beträchtlich.
Doch das ist nur die halbe Miete. Wer sich mit Sport und den Gesetzen des Körpers beschäftigt, weiß: Ein gutes Training endet nicht mit der letzten Wiederholung. Nach dem Sport ist vor dem Sport, und das Abkühlen, das bewusste Nachlassen der Spannung, ist ebenso entscheidend wie das Training selbst. Hier kommt das statische Dehnen ins Spiel – jener Moment der Ruhe, der zugleich auch der Weg zur Erholung ist. Denn dann bringen wir auch wieder vor allem das fasziale Gewebe wieder in seine ursprüngliche Länge und strukturieren dieses (Gummiband-Effekt!).
Anmerkung aus der Praxis: Dieser „Gummiband-Effekt“ gilt übrigens auch für die Gefäße, denn diese haben auch einen hohen Faszienanteil! So erklärt sich übrigens auch, warum z.B. Stretching gegen Herzinfarkt wirkt: Stretching gegen Herzinfarkt.
Jetzt können wir natürlich über einzelne Dehnübungen und deren Ausführung diskutieren… Positionen wie die Taubenstellung für die Hüfte oder die stehende Quadrizepsdehnung für die Hüftbeuger sind wahre Wunderwerke für die Muskulatur, die während des Trainings intensiv beansprucht wurde. Wenn Sie jede Position für 15 bis 30 Sekunden halten, erreichen Sie nicht nur eine nachhaltige Entspannung, sondern fördern auch die Regeneration und verkürzen so die Zeit bis zum nächsten Training. Dazu schreibe ich sicher noch mehr und entwickle auch gerade ein entsprechendes Programm. Wer sich dafür interessiert, schnell HIER in den Newsletter eintragen:
Der Schlüssel zur nachhaltigen Leistungssteigerung liegt also in der Kombination von dynamischem Aufwärmen und gezieltem statischen Dehnen nach dem Training. Diese einfache, aber effektive Praxis fördert nicht nur die Flexibilität, sondern trägt auch zu einer schnelleren Erholung und einer besseren Gesamtleistung bei. Wer sich fünf bis zehn Minuten für das Aufwärmen und ebenso viel für das Abkühlen nimmt, investiert in seine Gesundheit und in seine langfristigen Fitnessziele.
ABER Achtung!
Sportlern mit Beschwerden rate ich sich wie eben „aufzuwärmen“. An den trainingsfreien Tagen rate ich aber zu statischen Dehnübungen die über einen längeren Zeitraum gehalten werden um das Fasziengewee innerhalb von ca. 3 bis 6 Monaten „frei“ zu arbeiten. Dazu braucht es die richtige Übung, im richtigen Winkel und der richtigen Dauer UND in der optimalen Dehnvariante (z.B. Postisometrie). Klingt kompliziert? Tja… dafür braucht man einen Trainer / Therapeuten der sich damit gut auskennt und Erfahrung besitzt. So jemand war übrigens Joseph Pilates, aber das ist ein anderes Thema.
Fazit
Als Naturheilkundler und Sportwissenschaftler sage ich Ihnen: Es sind oft die kleinen, einfachen Dinge, die den entscheidenden Unterschied ausmachen. Dehnen ist nicht nur ein Ritual, sondern eine Einladung an den Körper, sich mit der Zeit zu versöhnen, anstatt gegen sie zu arbeiten. Wer sich in der Praxis des Dehnens übt, wer dem Körper das gibt, was er braucht, wird auf lange Sicht ein Stück mehr Freiheit erleben – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne!