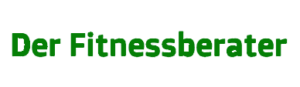Was tun, wenn das Muskelwachstum stagniert? Eine neue Studie liefert überraschende Einsichten und zeigt, wie durch gezielte Anpassungen im Training wieder Fortschritte erzielt werden können.
Es ist ein Phänomen, das viele Kraftsportler kennen: Trotz harter Arbeit im Fitnessstudio bleibt der Fortschritt aus. Das Muskelwachstum stagniert, die Gewichte scheinen nicht leichter zu werden – ein klassisches Plateau. Doch was tun, wenn das gewohnte Training nicht mehr greift?
Eine neue Studie von Marcelo A. S. Carneiro et al. (2022) beleuchtet, wie ein Wechsel der Trainingsintensität helfen kann, diese Sackgasse zu durchbrechen. Die Ergebnisse sind nicht nur für ältere Sportlerinnen relevant, sondern enthalten auch wichtige Erkenntnisse für andere Bevölkerungsgruppen.
Die Studie im Fokus
In der Untersuchung, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Sport Sciences for Health, wurde untersucht, wie unterschiedliche Intensitätswechsel innerhalb eines 24-wöchigen Krafttrainingsprogramms die Zunahme an fettfreier Körpermasse (Lean Body Mass, LBM) beeinflussen können. Dabei wurden 24 postmenopausale Frauen in zwei Gruppen aufgeteilt.
Eine Gruppe begann mit einem Training bei niedriger Intensität (ca. 30 % des 1RM, 27–31 Wiederholungen pro Satz), gefolgt von einem Training mit moderater Intensität (ca. 80 % des 1RM, 8–12 Wiederholungen pro Satz). Die andere Gruppe absolvierte die beiden Phasen in umgekehrter Reihenfolge.
Die vollständige Studie können Sie hier einsehen:
Ergebnisse und Erkenntnisse
Die Zunahme an LBM war in beiden Gruppen ähnlich, unabhängig von der Reihenfolge der Intensitäten. Doch die Details sind aufschlussreich: Teilnehmerinnen, die mit dem niedrigintensiven Training begannen, legten in der ersten Phase im Durchschnitt 400 Gramm fettfreie Masse zu, während jene, die mit moderater Intensität starteten, 300 Gramm gewannen.
In der zweiten Phase kehrte sich dieses Muster um. Interessant ist zudem, dass sogenannte „Low-Responder“ (Teilnehmerinnen mit geringen Zuwächsen in der ersten Phase) in der zweiten Phase deutlich mehr Fortschritte erzielten – unabhängig von der Intensität des Trainings.
Die Ergebnisse zeigen, dass der Fortschritt nicht von der anfänglichen Reaktion auf ein bestimmtes Trainingsprogramm abhängt. Vielmehr kann ein Wechsel der Trainingsintensität gerade für diejenigen, die anfangs wenig Erfolg hatten, neue Reize setzen und das Muskelwachstum fördern.
Was bedeutet das für Ihr Training?
Die Studie legt nahe, dass ein gezielter Wechsel der Trainingsintensität eine effektive Strategie sein kann, um Plateaus zu überwinden. Wer mit moderatem Training keine Fortschritte mehr erzielt, könnte von einem Wechsel zu niedrigintensivem Training profitieren – oder umgekehrt. Der Schlüssel liegt in der Variation: Durch unterschiedliche Belastungen und Wiederholungszahlen werden neue Reize gesetzt, die das Muskelwachstum wieder ankurbeln.
Weitere wissenschaftliche Perspektiven
Die Ergebnisse von Marcelo et al. stehen im Einklang mit anderen Studien, die individuelle Unterschiede in der Trainingsreaktion untersuchten. Eine Untersuchung von Beaven et al. (2008) zeigte beispielsweise, dass bestimmte Trainingsprotokolle, die auf die hormonellen Reaktionen der Teilnehmer abgestimmt wurden, zu signifikant besseren Kraftzuwächsen führten:
Eine weitere Studie von Jones et al. (2016) ging noch einen Schritt weiter und entwickelte einen Algorithmus, der auf genetischen Prädispositionen basierte. Teilnehmer, deren Trainingsprotokoll mit ihrer Genetik übereinstimmte, erzielten deutlich größere Fortschritte:
Auch Untersuchungen zu Trainingsvolumen und -frequenz, wie die von Damas et al. (2019), unterstreichen die Bedeutung individueller Anpassungen:
Damas et al. untersuchten zudem die Auswirkungen unterschiedlicher Trainingsfrequenzen in einem unilateralen Studiendesign:
- Individual muscle hypertrophy and strength responses to high vs. low resistance training frequencies
Dabei stellte sich heraus, dass das Trainingsvolumen weniger wichtig zu sein scheint als die angeborene Trainingsfähigkeit. Einige Personen erzielten mit höheren Trainingsvolumina und -frequenzen bessere Ergebnisse, während andere bei niedrigeren Volumina mehr Fortschritte machten.
Praktische Tipps für Ihr Training
- Variieren Sie die Intensität: Wenn Sie an einem Plateau angekommen sind, wechseln Sie zwischen niedrigen und moderaten Intensitäten.
- Experimentieren Sie mit dem Trainingsvolumen: Eine vorübergehende Erhöhung oder Reduktion der Sätze pro Muskelgruppe kann neue Reize setzen.
- Hören Sie auf Ihren Körper: Die Reaktion auf ein Trainingsprogramm kann individuell stark variieren. Probieren Sie unterschiedliche Ansätze aus, um herauszufinden, was bei Ihnen funktioniert.
- Langfristige Planung: Hypertrophie benötigt Zeit. Setzen Sie sich realistische Ziele und planen Sie Ihr Training in Zyklen, um Plateaus vorzubeugen.
Fazit: Kein Erfolg ohne Anpassung
Die Studie von Marcelo et al. zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, Trainingsprogramme individuell anzupassen. Wer sich fest an ein stures Schema klammert, riskiert, in einer Sackgasse stecken zu bleiben. Variation und Flexibilität sind der Schlüssel zu langfristigem Erfolg – unabhängig davon, ob Sie Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi sind.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
Dieser Beitrag wurde am 26.01.2025 erstellt.