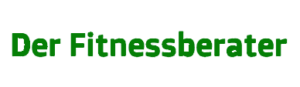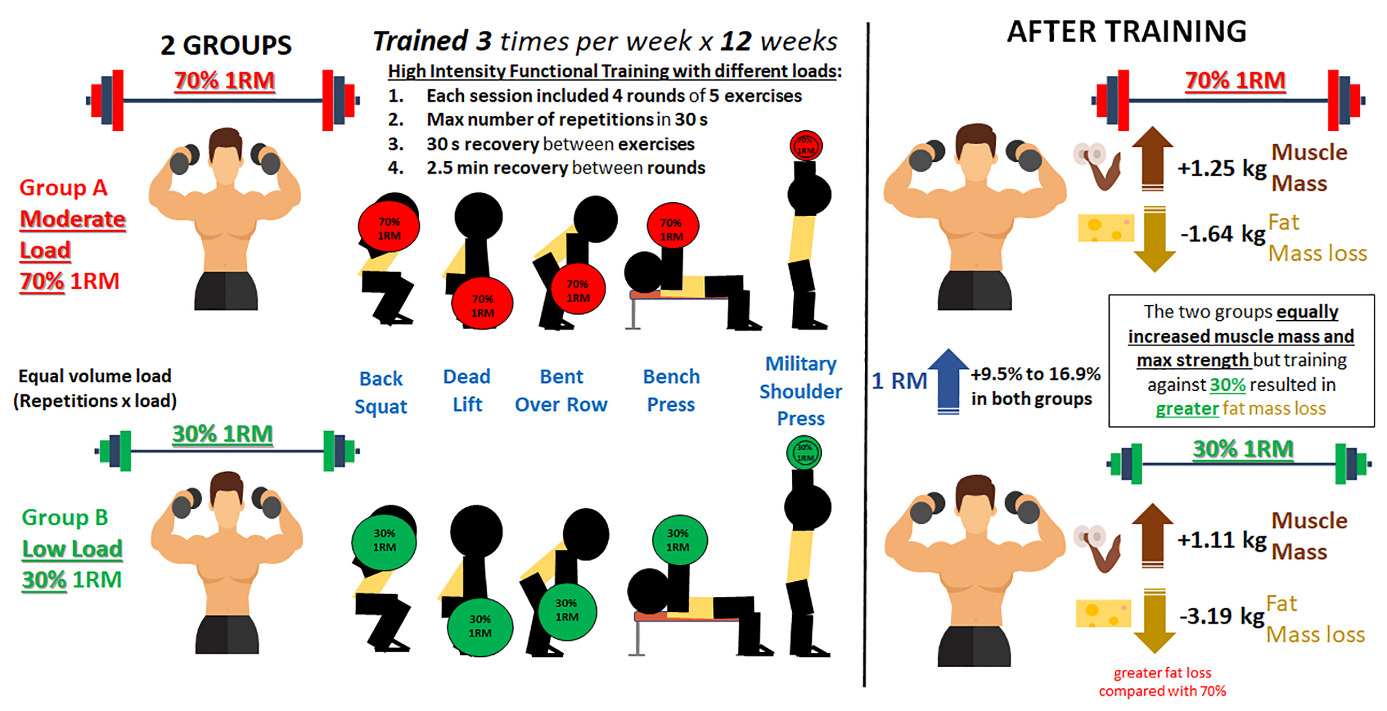Das Heavy Duty Training ist heute unter dem Begriff High Intensity Training (HIT) bekannt. Ursprünglich wurde es von Mike Mentzer, einem erfolgreichen amerikanischen Bodybuilder, entwickelt. Die Methode ist eine Kombination aus forced reps (erzwungene Wiederholungen) und negative reps (Negativwiederholungen), mit der der Muskel über das „normale“ Muskelversagen belastet wird. Das Heavy Duty wurde wieder bekannter, als Dorian Yates, sechsmaliger Mr. Olympia (1992-1997), verlautbarte, dass er nach diesem Prinzip trainiert. Yates adaptierte die Heavy-Duty-Prinzipien und machte sie in den 1990er-Jahren wieder populär. Yates‘ Ansatz war zwar etwas modifiziert, behielt jedoch den Fokus auf Intensität bei. Dazu aber später etwas mehr.
Vorab-Fazit: Mit der Heavy Duty Methode lassen sich gute Ergebnisse erreichen, wobei das eigentliche Training weit weniger zeitintensiv ist, als bei herkömmlichen Methoden des Krafttrainings, vor allem gegenüber dem „High-Volume-Training“. Allerdings erfordert ein HIT-Training auch längere Regenerationsphasen, in denen der Muskel sich entspannen und wachsen kann. Wie das genau aussieht, habe ich in folgendem Beitrag beschrieben.
Zuerst ein paar Worte zu Mike Metzer selbst:
Mentzer war meines Wissens erste und einzige Bodybuilder, der den Mr. Universe-Wettbewerb mit einer perfekten „vollen“ Punktzahl gewann. Dazu brachte er eine art „philosophische Note“ ins Bodybuilding. Seine Tränentropfen-Brille zeigte seine bücherliebende Persönlichkeit, und er liebte es, über verschiedene Denkschulen (besonders Ayn Rands Objektivismus) zu philosophieren und zu diskutieren, Kunst zu betrachten und guter Musik zu lauschen. Für viele Männer verkörpert diese Kombination aus Geist und Körperstärke das Idealbild von Männlichkeit. Legendär ist Mentzers Disput mit Arnold Schwarzenegger beim Mr. Olympia Wettkampf 1980. Doch das ist eine andere Geschichte.
Schauen wir auf das Heavy Duty Programm
Mentzers Heavy Duty-Programm erregt auch heute viel Aufsehen, da es außergewöhnliches Muskelwachstum verspricht, indem man jeden Körperteil nur einmal pro Woche trainiert.
Mentzers Idee, dass man mit seltenen und kurzen Workouts hypertrophes Wachstum erzielen kann, stand im Gegensatz zur Bodybuilding-Orthodoxie der 1970er und 80er Jahre. Damals war hohes Volumen Trumpf. Bodybuilder wie Arnold Schwarzenegger trainierten (vor allem in der Wettkampf-Saison) zwei Stunden, zweimal täglich, jeden Tag. Ziel war es, die Muskeln mit zweistelligen Satzzahlen zu stimulieren.
Beeinflusst von Arthur Jones‘ Philosophie des hochintensiven Trainings, dachte Mentzer, dass so viel Training Zeitverschwendung sei und zu suboptimalen Ergebnissen führe.
Die Prinzipien von Heavy Duty
Zuerst muss man erwähnen, dass Heavy Duty keine völlig einzigartige Trainingsphilosophie ist. Es ist eine Variation des hochintensiven Trainings (HIT), bei dem Athleten vorgeschrieben wird, ihre Muskeln bis zum Versagen zu trainieren. Wie oben erwähnt, war Arthur Jones ein Pionier des hochintensiven Trainings. Mentzer hat wahrscheinlich am meisten dazu beigetragen, das hochintensive Training durch seine Arbeit mit Dorian Yates in den 90er Jahren bekannter zu machen.
Mentzers Heavy Duty-Philosophie entwickelte sich über die Jahre. Die meisten Bodybuilder (und viele Sportwissenschaftler) denken, dass Mentzers frühe Version von Heavy Duty vieles richtig gemacht hat. Allerdings wurde Mentzer gegen Ende seines Lebens, insbesondere in Bezug auf Volumen und Häufigkeit, noch „extremer“.
Es sollte erwähnt werden, dass Mentzer genetisch gut für das Bodybuilding geeignet war und seine Statur teilweise durch den Einsatz von anabolen Steroiden erreichte. Er glaubte jedoch, dass seine empfohlenen Trainingspläne gleichermaßen für durchschnittliche und dopingfreie Bodybuilder geeignet waren, die ihr natürliches muskuläres Potenzial erreichen wollten.
Hohe Intensität: der Schlüssel zu Heavy Duty?
Für Mentzer war die Intensität der Übung der Treiber für Muskelhypertrophie, nicht das Volumen. Was meinte Mentzer also mit Intensität?
Er definierte sie als „den Prozentsatz des momentan möglichen muskulären Einsatzes“.
Mentzer (und andere Befürworter des hochintensiven Trainings) glaubten, dass man Wiederholungen so nahe wie möglich an 100% Anstrengung bringen musste, um Muskelwachstum zu stimulieren. Und man weiß nur, ob man 100% Anstrengung erreicht, wenn man bis zum Versagen trainiert.
Mentzer über Intensität:
Diese letzte Wiederholung, bei der du so hart wie möglich versuchst und es gerade so schaffst! Das ist es, was den Wachstumsmechanismus in deinem Körper aktiviert. Diese letzte fast unmögliche Wiederholung, bei der du mit den Zähnen knirschst, am ganzen Körper zitterst, Hilfe benötigst! Diese Wiederholung ist sehr besonders, sie unterscheidet sich von den anderen. Etwas Besonderes passiert in deinem Körper, wenn das geschieht.
Wissenschaftliche Forschung hat diese Behauptung bestätigt. Je näher man beim Heben dem Versagen kommt, desto mehr erfahren die Muskelfasern die entsprechende Stimulierung. Man weiß, dass man diese Spannung erreicht, wenn sich die Bewegung des Hebens verlangsamt und schwer anfühlt. Diese Wiederholungen sind die „stimulierenden Wiederholungen“. Sie sind diejenigen, die eine Kaskade von Signalen in deinem Körper auslösen, um mehr Hypertrophie zu bilden.
Um sicherzustellen, dass man ausreichend Intensität erreicht, müssen die Bewegungen bei den einzelnen Wiederholungen kontrolliert sein. Hebe und senke das Gewicht sanft und langsam, ohne Rucke oder plötzliche Bewegungen. Man möchte keinen Schwung in die Wiederholung bringen, was diese erleichtern würde. Ein häufiges Tempo bei hochintensiven Praktizierenden ist 2-2-4. Zwei Sekunden für den konzentrischen Teil der Hebung, eine zweisekündige Pause und vier Sekunden für den exzentrischen Teil der Wiederholung.
Um die Intensität zu steigern, befürwortete Mentzer Dinge wie „Pre-Exhausting“ einer Muskelgruppe, unterstütztes Heben (wo man jemandem bei den letzten Wiederholungen hilft) und das Gewicht an verschiedenen Punkten in der Hebung konstant zu halten. Alle diese Methoden wurden entwickelt, um einem Bodybuilder zu helfen, schneller an den Punkt des Versagens zu gelangen.
Die große Erkenntnis aus diesem Prinzip ist, dass man, um Muskelwachstum zu stimulieren, jede Übung bis zum Versagen durchführen muss.
Niedrige Dauer (oder niedriges Volumen)?
Der große Reiz der Heavy Duty-Methode ist das geringe Volumen, das man absolviert.
Obwohl man mechanische Spannung mit einer hohen oder niedrigen Anzahl von Wiederholungen erreichen kann, ist es einfacher, die für die Spannung notwendige Intensität mit letzterem zu erreichen.
Wenn man leichtere Gewichte verwendet, muss man mehr Wiederholungen machen, bevor die Muskeln einen entsprechenden Stimulus erfahren. Als Ergebnis erlebt man mehr Ermüdung, was es schwieriger macht, die muskelbildende Intensität der Wiederholungen aufrechtzuerhalten.
Wenn man schwerere Gewichte verwendet, kann man weniger Wiederholungen machen, während man schneller in die Intensität einsteigt, die notwendig ist, um die nötige Intensität zu erzeugen.
Denken Sie daran: Wenn Sie Bizeps-Curls mit 5-Kilo-Hanteln machen, könnten Sie 50 Wiederholungen benötigen, um die Intensität für muskelbildende mechanische Spannung zu erreichen, und Sie könnten ermüden, bevor Sie diesen Punkt überhaupt erreichen. Wenn Sie mit 25-Kilo-Hanteln curlen, könnten Sie die notwendige Spannung vielleicht schon in nur 3 Wiederholungen erreichen, wodurch Sie weitere Ermüdung und Zeit sparen.
Mentzer dachte, man könnte die gesparte Zeit nutzen, um Philosophie oder Kunst zu studieren.
Wie oben erwähnt, entwickelte sich Mentzers Philosophie zum Volumen im Laufe der Jahre. Als er Heavy Duty zum ersten Mal vorstellte, verschrieb er 1 bis 2 Sätze von 6 bis 8 Wiederholungen für jede Übung, die bis zum Versagen durchgeführt wurden. Wenn man 12 Wiederholungen in einem Satz schaffte, musste man das Gewicht um 10% erhöhen, die Wiederholungen wieder auf 6 reduzieren und sich mit den Wiederholungen bei diesem neuen Gewicht wieder nach oben arbeiten.
Wie sieht das also praktisch aus?
Beispiel Oberschenkel. Ein Mentzer-Heavy-Duty-Programm könnte wie folgt aussehen:
Beinstrecken: 2 Sätze, bis zum Versagen Kniebeugen: 1 Satz, bis zum Versagen Beinpresse: 1 Satz, bis zum Versagen Das sind insgesamt 4 Sätze für die Quadrizeps.
Ein Trainingsprogramm mit hohem Volumen könnte dich dazu bringen, 4 Sätze jeder Übung zu machen, was insgesamt 12 Sätze für deine Quadrizeps ergibt.
4 Sätze im Vergleich zu 12 Sätzen. Man kann sehen, warum Heavy Duty als ein Programm mit geringem Volumen gilt.
In den 1990er Jahren entwickelte Mentzer Heavy Duty II, welches Workouts vorschlug, bei denen man nur einen Satz pro Muskelgruppe machte.
Ein vorgeschlagenes Programm sah so aus:
Workout 1
Kniebeugen: 1 Satz, bis zum Versagen Klimmzüge mit engem Griff und Handflächen nach oben: 1 Satz, bis zum Versagen Dips: 1 Satz, bis zum Versagen
Workout 2
Kreuzheben: 1 Satz, bis zum Versagen Drücken hinter dem Nacken: 1 Satz, bis zum Versagen Wadenheben im Stehen: 1 Satz, bis zum Versagen Das ist alles.
Wie oben erwähnt, denken die meisten Bodybuilder, dass Mentzer mit seiner früheren Version von Heavy Duty richtig lag. Die wissenschaftliche Forschung scheint Mentzers ursprüngliche Volumenempfehlungen zu bestätigen.
Laut Paul Carter legt die Forschung nahe, dass allgemein gesehen, über 8 Sätze pro Woche pro Muskelgruppe bis zum Versagen hinaus, wenig bis kein Nutzen besteht, das Volumen zu erhöhen. Wenn man mehr als das macht, ermüdet man sich nur unnötig. Während ein Satz bis zum Versagen pro Woche einen Reiz für das Muskelwachstum bietet, ist es wahrscheinlich nicht genug für maximale Hypertrophie. Laut Paul deutet die Forschung darauf hin, dass 3 Sätze pro Woche pro Muskelgruppe das Minimum für hypertrophe Gewinne zu sein scheinen.
Allerdings deuten einige Bodybuilder und einige Studien darauf hin, dass man mit mehr Volumen mehr hypertrophes Wachstum erzielt. Wie im Bereich von 12-20 Sätzen pro Muskelgruppe pro Woche.
Welches ist es also? Es ist schon lange ein Thema dieser ganzen Debatte rund um das Heavy Duty…
Solange man bis zum Versagen trainiert, wird sowohl ein hohes als auch ein geringes Volumen gut für das Muskelwachstum des Durchschnittstypen funktionieren, also wähle die Methode, die dir am besten gefällt. Der große Vorteil des Trainings mit geringem Volumen ist, dass man in kürzerer Zeit muskulös werden kann.
Niedrige Frequenz Erholung war ein wesentlicher Teil von Mentzers Heavy Duty Philosophie, denn Erholung ist der Zeitpunkt, an dem unsere Muskeln vom Stimulus des Gewichthebens wachsen. Um die Erholung zu maximieren, befürwortete Mentzer, die Workouts deutlich zu verteilen. In der extremsten Version von Heavy Duty verordnete er 1 bis 2 Sätze für eine Muskelgruppe nur einmal pro Woche. Die anderen sechs Tage würden zur Erholung genutzt.
Die Forschungsergebnisse sind gemischt, ob niedrige Frequenz der Hypertrophie hilft oder schadet. Eine Meta-Analyse zeigte, dass es egal ist, ob man einmal oder zweimal pro Woche trainiert, solange man genügend Sätze bis zum Versagen für eine gegebene Muskelgruppe während einer Woche absolviert.
Nehmen wir also an, du strebst an, 6 Sätze pro Woche für deine Brust zu machen, wobei 6-8 Wiederholungen pro Satz das ideale Spektrum sind, manchmal bis zu 12, wenn man stärker wird, bevor man das Gewicht um 10% erhöht und wieder auf 6 Wiederholungen pro Satz zurückgeht.
Du könntest einen Brusttag haben, an dem du alle 6 Sätze für die Woche in diesem einzelnen Workout machst.
Es könnte so aussehen:
Flydeck: 2 Sätze, bis zum Versagen Schrägbankdrücken: 2 Sätze, bis zum Versagen Kabelzug-Crossover: 2 Sätze, bis zum Versagen Dann würdest du deinen Brusttag eine Woche später wiederholen.
Du könntest auch diese 6 Sätze auf 2 Workouts aufteilen, wie folgt:
Workout 1
Flydeck: 2 Sätze, bis zum Versagen Schrägbankdrücken: 1 Satz, bis zum Versagen
Workout 2
Kabelzug-Crossover: 2 Sätze, bis zum Versagen Bankdrücken: 1 Satz, bis zum Versagen Laut der oben genannten Meta-Analyse wäre jede Aufteilung in Ordnung.
Aber eine andere, neuere Studie deutet darauf hin, dass das Training einer Muskelgruppe mehr als einmal pro Woche mehr Vorteile hat als nur einmal pro Woche, selbst wenn die Gesamtanzahl der Sätze gleich bleibt.
Ich konnte keine starke Übereinstimmung unter Bodybuildern bezüglich der Frequenz finden. Oft kam es auf die persönliche Vorliebe an. Solange man sein Volumen zwischen 3 und 8 Sätzen pro Woche für eine gegebene Muskelgruppe erreicht, hängt die Häufigkeit des Trainings davon ab, was man tun möchte.
Progressive Überlastung Für Mentzer ist die progressive Überlastung ein Indikator dafür, ob das Programm funktioniert. Wenn man Wiederholungen zu einem Satz hinzufügen kann, bevor man das Versagen erreicht, oder das Gewicht bei jedem Workout erhöht, treten die Anpassungen in den Muskeln auf, die das hypertrophe Wachstum fördern.
Etwas, was Mentzer betonte, ist, dass es beim Muskelwachstum zuerst um Kraft geht. Man wird sich zunächst stärker fühlen, bevor man sich größer fühlt. Das liegt daran, dass wir neuronale Anpassungen erwerben, die es uns ermöglichen, schneller schwerer zu heben, als wir Muskelgewebe aufbauen. Erwarte, dass es mehrere Monate dauert, bevor du sichtbare Zunahmen der Muskelgröße bemerkst.
Dorian Yates und die „Wiederbelebung“ des Heavy Duty in den 90ern
Eingangs hatte ich es bereits angesprochen. Dorian Yates, sechsmaliger Mr. Olympia (1992-1997), adaptierte die Heavy-Duty-Prinzipien und machte sie in den 1990er-Jahren wieder populär. Yates‘ Ansatz war zwar etwas modifiziert, behielt jedoch den Fokus auf Intensität bei. Yates drehte eine DVD mit dem Namen: „Blood and Guts“. Durchaus sehenswert, denn die Intensität lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Sucht auf Youtube nach Blood and guts Dorian Yates und seht es euch an.
Unterschiede zwischen Yates und Mentzer
- Yates verwendete ein etwas höheres Volumen: Obwohl er immer noch sehr wenige Sätze machte, absolvierte er mehr Übungen pro Muskelgruppe als Mentzer.
- Yates‘ Fokus auf Technik: Er legte großen Wert auf die perfekte Ausführung, wobei auch die Sicherheit im Vordergrund stand.
- Regeneration: Yates trainierte mit einem Split-System, das ihm erlaubte, bestimmte Muskelgruppen intensiver zu belasten und gleichzeitig längere Pausen für andere Gruppen zu lassen.
Kritik am Mentzer Heavy Duty Training
Die Methode ist nicht unumstritten, da sie vor allem bei unerfahreneren Athleten ein hohes Verletzungsrisiko birgt. Ich halte es für dringend erforderlich, diese Art des Trainings zu periodisieren. Sechs Wochen sehe ich als das Maximum, nach dem „Heavy Duty“ trainiert werden sollte. Genau Trainingsplanprotokolle sollten kontinuierliche Fortschritte zeigen.
Als Einstieg in ein Krafttraining ist die Methode nicht geeignet. Für ein Einsteiger empfehle ich prinzipiell ein herkömmliches 3 Satz Training. Dieses fördert sowohl intramuskuläre, intermuskuläre Koordination und stimuliert die Hypertrophie (Muskelwachstum).
Mike Mentzer selbst starb übrigens schon im Alter von 49 Jahren an Herzversagen. Und Dorian Yates zog sich einige Muskelverletzungen zu.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
Dieser Beitrag wurde im März 2009 erstmalig erstellt und am 3.12.2024 letztmalig ergänzt.