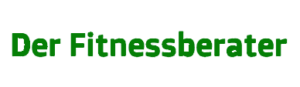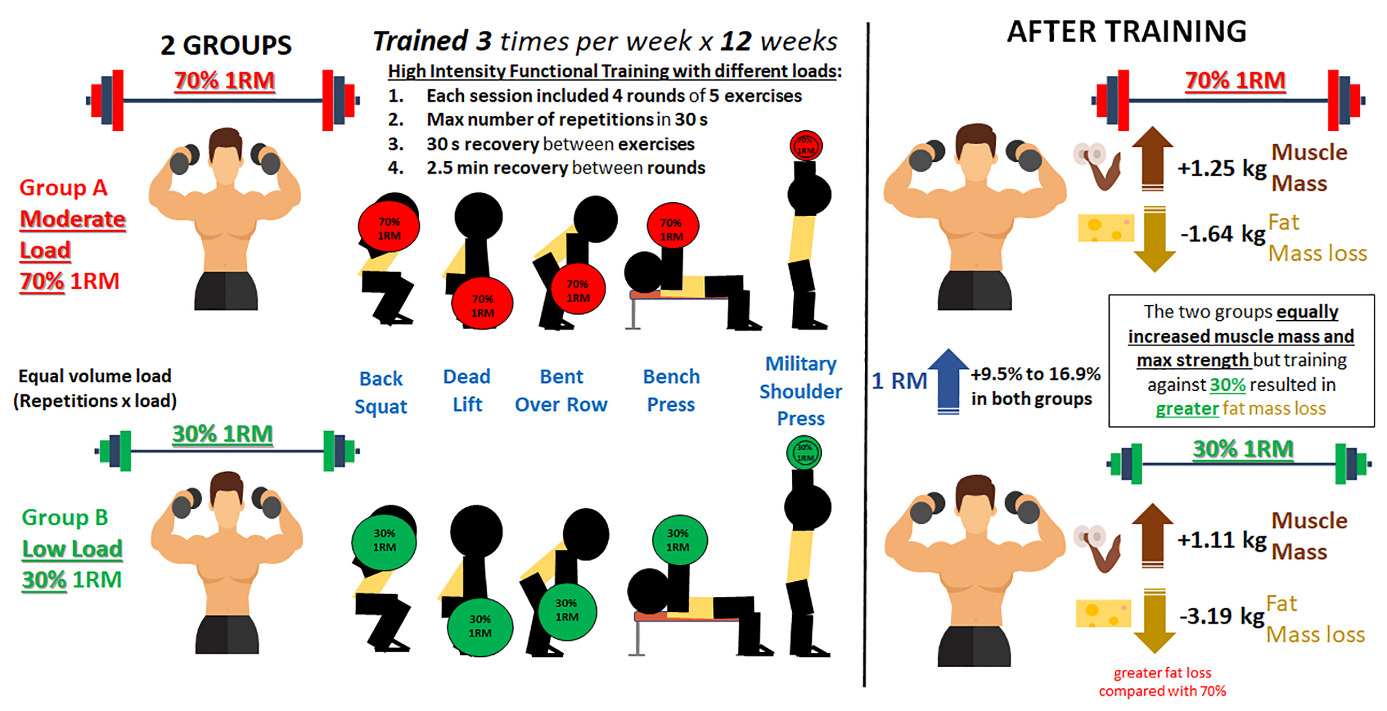Wassergymnastik über zehn oder mehr Wochen kann den Taillenumfang reduzieren und die Gewichtsabnahme unterstützen. Das belegt eine gepoolte Datenanalyse verfügbarer Erkenntnisse, die im Open-Access-Journal BMJ veröffentlicht wurde. [1]
Die Analyse zeigt: Diese Art von Training ist besonders effektiv bei übergewichtigen/adipösen Frauen und über 45-Jährigen.
Das Adipositas-Problem weltweit
Globale Schätzungen für 2022 sind alarmierend: Mehr als 43% der Erwachsenen weltweit sind übergewichtig, 504 Millionen Frauen und 374 Millionen Männer adipös. Adipositas trägt jährlich zu schätzungsweise 2,8 Millionen Todesfällen bei.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Warum Wasser-Aerobic so effektiv ist
Der Auftrieb des Wassers reduziert Gelenkverletzungen, die häufig mit Übungen an Land bei übergewichtigen Menschen verbunden sind. Obwohl Wassergymnastik zur Gewichtsabnahme empfohlen wird, waren die genauen Auswirkungen auf die Körperzusammensetzung, insbesondere zentrale Adipositas, bisher unklar.
Die Studienmethodik im Detail
Die Forscher durchsuchten Forschungsdatenbanken nach relevanten Studien bis Ende 2021. Sie verglichen Wassergymnastik mit anderen Trainingsarten oder gar keiner Behandlung bei übergewichtigen oder adipösen Erwachsenen (BMI ≥ 30).
Studienumfang:
- 10 klinische Studien mit 286 Teilnehmern
- Altersbereich: 20-70 Jahre
- Durchführungsländer: Malaysia, Brasilien, Indien, USA, Niederlande
Trainingsformen und -intensität
Die Wassergymnastik umfasste Aerobic, Zumba, Yoga und Joggen über 6-12 Wochen. Die Trainingshäufigkeit betrug meist zwei- bis dreimal pro Woche mit 60-minütigen Einheiten.
Die beeindruckenden Ergebnisse
Gewichtsverlust und Körpermaße
Die Analyse ergab signifikante Verbesserungen:
- Gesamtgewicht: Reduktion um durchschnittlich fast 3 Kilogramm
- Taillenumfang: Verringerung um 3 Zentimeter
Detailanalyse nach Zielgruppen
Trainingseinheiten von mehr als zehn Wochen zeigten besonders starke Effekte:
- Frauen: Körpergewicht signifikant um mehr als 3kg reduziert
- Personen ab 45 Jahren: Taillenumfang um fast 3cm verringert
Grenzen der Wirksamkeit
Wassergymnastik zeigte keine signifikanten Verbesserungen bei:
- BMI-Reduktion
- Körperfettanteil
- Fettgewebe
- Taille-Hüft-Verhältnis
- Hüftumfang
Bei Männern und Personen unter 45 Jahren waren die Effekte minimal – allerdings waren diese Gruppen in den Studien unterrepräsentiert.
Qualität der wissenschaftlichen Evidenz
Die Studienqualität wurde nach dem GRADE-System bewertet:
- Moderat: Körpergewicht und Taillenumfang
- Niedrig: BMI, Muskelmasse, Fettmasse, Taille-Hüft-Verhältnis, Hüftumfang
- Sehr niedrig: Körperfettanteil
Diese Bewertungen resultieren hauptsächlich aus geringen Teilnehmerzahlen und variierenden Studiendesigns.
Studienlimitationen
Die Forscher räumen verschiedene Einschränkungen ein:
- Nur englischsprachige Studien berücksichtigt
- Teilweise kurze Interventionszeiträume (6 Wochen)
- Geringe Teilnehmerzahlen in einzelnen Studien
Fazit der Wissenschaftler
Trotz Limitationen unterstützt „die moderate Vertrauenswürdigkeit der Evidenz für Körpergewicht und Taillenumfang den Einsatz von Wassergymnastik als wirksame Intervention zur Reduzierung des Gesamtkörpergewichts und der zentralen Adipositas.“
Praktische Aqua-Fitness-Erfahrungen
Ich konnte einen Beitrag liefern, der sich mit „Aqua Fitness“ beschäftigte. [2]
Dort zeige ich, dass Bewegung im Wasser – sei es Aqua Boxing, Jogging, Bouncing oder Cycling – mehr als nur Pfunde reduziert: Sie erhöht die Fitness und stärkt die Muskulatur. Und das alles ohne die sonst übliche Belastung von Gelenken und Knochenapparat bei entsprechenden sportlichen Aktivitäten auf dem Trockenen.
Ausblick für zukünftige Forschung
Die Wissenschaftler fordern: „Zukünftige Forschung sollte diese Einschränkungen durch größere, gut konzipierte randomisierte kontrollierte Studien mit standardisierten Methoden und unterschiedlichen Populationen beheben. Die Untersuchung der Langzeiteffekte von Wassergymnastik und der Vergleich mit anderen Trainingsmethoden wird wertvolle Erkenntnisse liefern.“
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
Quellen:
- [1] Effects of water aerobics on body composition in obesity and overweight people: a systematic review and meta-analysis | BMJ Open
(https://bmjopen.bmj.com/content/15/3/e091743) - [2] Aqua Fitness – Der Fitnessberater
(https://www.der-fitnessberater.de/blog/aqua-fitness/)
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 erstellt.