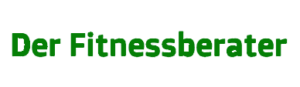Die Sache mit dem Sporttreiben, körperlichen Aktivitäten und verwandten Kalorienkillern ist heute kein Gegenstand für kontroverse Diskussionen mehr: Heute weiß jeder und will jeder wissen, dass Sport nicht Mord, sondern gesund ist und schon immer gewesen ist.
Dabei fällt auf, dass es sich hier nicht um alternative Gesundheitsapostel und ähnlich denkende Zeitgenossen handelt, die dies propagieren. Das tun sie zwar auch. Aber es sind Kreise, von denen man diese Aussagen niemals nie so erwartet hätte: Die Lebensmittelindustrie, wie Pepsi, Cola-Cola, Nestlé und so weiter.
Grund für diese überraschende Einsicht ist aber nicht das Wohl der Kunden, sondern eine Ernährungsideologie, die den Grundstein fürs eigene Geschäft darstellt. Denn die Zuckerprodukte dieser Lebensmittelhersteller, die alles andere als gesundheitsförderlich sind, werden durch den Sport verharmlost.
Wie? Man behauptet einfach, dass die Kalorien, die angeblich ja alle gleich sind, durch den Sport wieder verbrannt werden. Und dann gibt es auch keine kalorischen Überschüsse, die den Konsumenten dick werden lassen. Oder mit anderen Worten: Wer dick ist, trägt selbst die Schuld, da man zu wenig Sport betrieben = Kalorien verbrannt hat.
Und wie wär es mit „weniger essen“?
Oder anders essen?
Warum das denn?
„Man gönnt sich doch sonst nichts“, lautet der übliche Einspruch.
Heute wissen wir, dass ein gesunder Körper auf rund 80 Prozent gesunder Ernährung fußt und „nur“ auf 20 Prozent Bewegung. Hieraus lässt sich ableiten, dass der Sportteil in unserem Gesundheitsprogramm, auch wenn er noch so intensiv durchgeführt wird, die „Sünden“ der Ernährung nie und nimmer kompensieren kann.
Aber genau das suggeriert uns die Lebensmittelindustrie, damit sie ihre ungesunden Nahrungsangebote teuer an den Mann bringen kann.
Auf der anderen Seite soll dies jetzt kein Aufruf sein, sich nur gesund zu ernähren, damit man die 20 Prozent körperliche Aktivität umgehen kann. Diese „Mengenangabe“ ist insofern fiktiv, da hier nur vordergründig die Effekte in Betracht gezogen werden, die auf die Gesundheit einen mehr oder weniger deutlichen Einfluss haben.
Was „hinter den Kulissen“ geschieht, das liegt weitestgehend noch im Dunkeln. Es gibt jetzt Hinweise, dass nicht nur die Nahrungsmittel in der Lage sind, Gene im Organismus an- und abzuschalten und damit die entsprechenden biochemischen Abläufe zu ändern (Wie Fasten die Gene positiv verändern kann).
Die gleichen Hinweise gibt es auch für die körperliche Bewegung. Ob es sich hier auch um ein 80/20-Verhältnis handelt, darüber gibt es absolut keine Angaben. Von daher scheint es nicht empfehlenswert zu sein, diese „20 Prozent“ als der Weisheit letzter Schluss anzusehen und von daher zu unterschätzen oder zu vernachlässigen. Vorerst nicht…
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
Der genetische Link zur körperlichen Aktivität
Eine Studie aus dem Jahr 2011 aus Taiwan (Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study.) mit über 400 Tausend Teilnehmern kam zu dem Ergebnis, dass ein tägliches Trainingsprogramm von nur 15 Minuten die Lebenserwartung um 3 Jahre verlängern kann.
Vielleicht liegt der Grund darin, dass körperliche Aktivität insofern gesundheitliche Vorteile bringt, indem eine Reihe von physiologischen Parametern gestärkt werden, die wiederum unabdingbar sind für einen gesunden Organismus: Normalisierung des Blutdrucks, Stabilisierung eines normalen Körpergewichts und des Blutzuckerspiegels, anti-depressive Wirkung etc.
Und die Liste der gesundheitlichen Vorteile durch Sport scheint stetig zu wachsen, belegt durch neue Erkenntnisse, wie unser komplexes biologisches System funktioniert. Und eine dieser neuen Erkenntnisse ist eben, dass als Minimalanforderung an Bewegung und Aktivität als gesundheitliche Förderungsmaßnahme kein Marathonlauf pro Tag erforderlich ist.
Dies sind insofern „gute Nachrichten“, da intensives Training nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Laut Statistik sind in Deutschland knapp 52 Prozent der Männer und knapp 50 Prozent der Frauen „mindestens eine Stunde in der Woche“ aktiv.
Das liegt aber immer noch deutlich unter den oben diskutierten 15 Minuten pro Tag (= 1 Stunden und 45 Minuten pro Woche). In den USA scheint es noch katastrophaler auszusehen, laut CDC: Hier sind es gerade einmal 20 Prozent der Bevölkerung, die diesem Anspruch gerecht werden.
Eine Studie, die im November 2013 veröffentlicht wurde, ging der Frage nach, warum so viele Zeitgenossen körperliche Aktivitäten meiden, wo es doch auch die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass das gesund ist. Und hier taucht der Hinweis auf eine mögliche genetische Verknüpfung auf.
Forscher der Universität von Georgia (Hate Exercise? It May Be in Your Genes) entdeckten, dass genetische Faktoren die Steuerung für Belohnung und Wohlbefinden im Gehirn beeinflussen. Dies sind im Wesentlichen die Gene, die die Ansprechbarkeit auf Dopamin im Gehirn steuern.
Dopamin ist einer der Neurotransmitter, der das Gefühl von „Belohnung“ steuert und erzeugt. Der Transmitter wird immer dann freigesetzt, wenn man etwas erfährt, was als Spaß und Freude empfunden wird. Treten diese Ereignisse vollkommen unerwartet auf, wie der Sechser im Lotto zum Beispiel, dann wird deutlich mehr an Neurotransmitter freigesetzt.
Aber auch bei erwarteten Ereignissen werden signifikante Mengen an Dopamin freigesetzt und somit das spezifische Gefühl von Freude und Zufriedenheit erzeugt.
Die Anlässe für die Dopamin-Freisetzung sind allerdings unterschiedlich, wie es den Anschein hat. Es gibt Menschen, die eine vermehrte Dopamin-Freisetzung während der sportlichen Betätigen erfahren. Für diese Menschen wird Sport somit zu einem Mittel, sich zu belohnen und sich ein gutes Gefühl zu verschaffen.
Bei anderen Menschen funktioniert dieser Weg überhaupt nicht. Hierfür scheinen Variationen in der genetischen Kontrolle der Dopamin-Rezeptoren verantwortlich zu sein, sowie weitere Gene, die neurale Signale steuern. Oder mit anderen Worten: Bei diesen Leuten kommt es bei sportlicher Betätigung zu keiner Dopamin-Freisetzung und damit zu keiner „Belohnung“ im Oberstübchen.
Warum die einen Gene haben, die bei Sport „sich freuen“ und andere nicht, diese Frage bleibt aber immer noch im Raum stehen. Der Mechanismus, der hinter der genetischen Kontrolle für Dopamin-Freisetzung oder keine Freisetzung bei Sport und körperlicher Aktivität steht, ist damit keinesfalls geklärt.
Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass die unterschiedlichen Aktivitäten der Gene auch auf sozialen Mustern beruhen. Denn Persönlichkeit und Verhaltensmuster scheinen einen Einfluss auf die Einstellung gegenüber Sport auszuüben. Hier sind Dinge in Betracht zu ziehen, wie die Fähigkeit zur Selbstkontrolle, soziale Einflüsse, Möglichkeiten für Fitnessaktivitäten, Zielsetzungskapazitäten, die körperliche Fitness und Geschicklichkeit.
Menschen mit höherer Motivationsbereitschaft und Selbstmotivation scheinen hier einen „genetischen“ Vorteil zu haben.
Meine Gene, deine Gene, ohne Gene
Die von der Universität Georgia gemachten Beobachtungen sind interessant, da sie bestimmte Verhaltensweisen und Einstellungen zum Sport etc. erklären können. Sie können aber nicht erklären, warum und wie die einen „Anti-Sport-Gene“ haben, die beim Waldlauf kein Dopamin freisetzen, und warum andere mit dem Waldlauf nicht mehr aufhören wollen.
Und welchen genauen Einfluss haben Motivationsbereitschaft und Selbstmotivation auf diese spezifischen Gene? Oder sind die selbst nur Produkt von anderen Genen?
Wenn wir von Genen und Genetik reden, dann kommt das alte Biologie-Wissen von einst aus der Schule wieder hoch, dass alles Genetische in Stein gemeißelt ist. Haar- und Augenfarbe, Körpergröße, Aussehen und so weiter sind nur durch Notoperationen veränderbar. Eine natürliche individuelle Variation oder Veränderung ist nicht möglich. So hieß es seinerzeit.
Das mag durchaus richtig sein für diese Bereiche. Aber nicht alles, was genetisch ist, ist unveränderbar. Ich hatte zu Beginn schon davon gesprochen, dass Gene sich an- und abschalten. Und die Genetik ist die Wissenschaft, die die Bedingungen dafür erforscht.
Und hier hat sich gezeigt, dass neben der gesunden Ernährung auch die körperliche Betätigung einen Einfluss auf die Genetik haben kann beziehungsweise hat. Einfaches Beispiel: Training lässt die Muskelmasse wachsen. Dieser Prozess ist genetisch gesteuert und findet nur statt, wenn die Muskulatur belastet wird. Ohne Belastung bleiben die Gene stumm und das Wachstum der Muskelmasse bleibt aus. Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass dieses Beispiel das Einzige sein sollte.
Ein Vergleich zwischen dem Erscheinungsbild von modernen Menschen und den steinzeitlichen Jäger-Sammler-Individuen ergibt eine Reihe von Hinweisen, wie die körperlichen Aktivitäten charakteristische Eigenschaften des Aussehens, Statur etc. haben verändern können, die sich auch im Genom verankert haben müssen.
Denn niemand wird als aktives Steinzeitmensch-Baby geboren und reift durch Stillsitzen in der Schule und Schreibtischarbeit in der Berufswelt zum modernen Menschen heran, inklusive das dazugehörige Aussehen.
Vielmehr sieht es so aus, das körperliche Aktivität immer noch eine starke genetische Grundlage in unserem Genom hat, auch wenn wir nicht mehr so sehr wie Steinzeitmenschen aussehen. Eine Vernachlässigung dieser genetischen Prädisposition jedoch scheint für das gesundheitliche Wohlbefinden absolut kontraproduktiv zu sein.
In dem Maße, wie der moderne Mensch sesshaft wurde, in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes (oder sollte es besser heißen: sitzhaft?), nahmen chronische Leiden zu, während die ursprünglichen Todesursachen, die in der jüngeren Menschheitsgeschichte Vorrang hatten, abnahmen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Heute leiden wir an Übergewicht, Diabetes, Autismus, Alzheimer, Bluthochdruck, Osteoporose, wofür es beim „Urmenschen“ kaum Hinweise gibt. Auch der mögliche Hinweis, dass die Urmenschen nicht alt genug geworden sind, um solche Erkrankungen zu bekommen, wird durch die Beobachtung relativiert, dass die oben beschriebenen chronischen Leiden inzwischen mehr und mehr bei immer jüngeren Menschen auftreten.
Nachdem wir festgestellt haben, dass Gene an der Dopamin-Freisetzung beteiligt sein können und unter Umständen den Spaß am Sport verderben, und nachdem wir auch gesehen haben, dass Gene durch Umweltvarianten verändert beziehungsweise manipuliert werden können, ist es an der Zeit, festzustellen, wer warum davon wie betroffen ist.
Die Forscher der Universität von Iowa hatten nämlich feststellen können, dass die (genetisch kontrollierten) Kapazitäten für körperliche Aktivität begrenzt sind. Das ist nichts Außergewöhnliches zunächst. Eher außergewöhnlich ist die Erkenntnis der Forscher, dass 50 Prozent der Leute, die mit einem Fitness-Training beginnen, innerhalb der ersten 6 Monate damit wieder aufhören.
Warum das? Für die Forscher ist die beste Erklärung hierfür die Tatsache, dass die meisten Anfänger nicht in der Lage sind, die Intensität und Belastung des Trainingsprogramms richtig einzuschätzen und zu kontrollieren. Sie überlasten/überschätzen sich selbst und scheitern im Laufe der Zeit.
Und ohne die notwendige Erfahrung und Überschätzung der eigenen Belastungsfähigkeit wird die Effektivität des Trainings so reduziert, das keine Erfolge möglich sind. Die Folge: Frustration, vielleicht sogar erhöhte Verletzungsneigungen und schlussendlich die Aufgabe.
Grundlage für die Trainingskapazitäten scheint die Fähigkeit zu sein, Gase auszutauschen – also Sauerstoffeinnahme und Kohlendioxidabgabe. Verläuft dieser Austausch nur schleppend, ist auch die körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Und diese Grenze zu wissen, ist insofern wichtig, als dass man sich als Neuling keine unlösbaren Belastungen zumutet, die nur kontraproduktive Konsequenzen mit sich bringen.
Strategien für die Belohnung
Dieses Kapitel ist schnell beschrieben. Wenn Gene unsere Dopamin-Freisetzung regulieren, dann müssen wir unsere Gene überlisten und sie veranlassen, auch dann Dopamin freizusetzen, wo sie normalerweise keine Freisetzung durchführen. Und wie überlistet man seine Gene?
Indem man einer Aktivität nachgeht, die einem wirklich Freude macht = wo Dopamin mit im Spiel ist. Dann kombiniert man diese Aktivität mit sozialen Aspekten: Man macht sie zusammen mit Familienmitgliedern, Freunden und so weiter. Denn ohne eine Aktivität, die man gerne macht, und ohne Mitstreiter ist der Misserfolg so gut wie garantiert.
Die rein akademische Erkenntnis, dass Sport gesund ist, kann auf den Spruch „der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach“ reduziert werden. Und wenn gesunder Sport zur Qual wird, das wäre die nächste Frage, ist Sport dann noch gesund?
Fazit
Sport ist gesund, aber oft lästig. Grund für die eher verhaltene Begeisterung für gesunden Sport scheinen in einem gewissen Rahmen Gene zu sein, die die Ausschüttung von Dopamin, dem Belohnungs-Neurotransmitter, kontrollieren. Diese Gene lassen sich aber „überlisten“, indem man nicht das macht, was uns als gesund empfohlen wird, sondern das, was die Dopamin-Gene aktiviert = Spaß macht.
Zusammen mit anderen, die die gleichen Interessen an der fraglichen Aktivität haben, ergibt sich ein weiterer Motivationsschub, der für die Nachhaltigkeit der Maßnahme wichtig ist.
Übrigens: Wenn Dich solche Informationen interessieren, dann fordere unbedingt meinen kostenlosen Fitness-Newsletter dazu an:
Dieser Beitrag wurde erstellt am 01.03.2017.